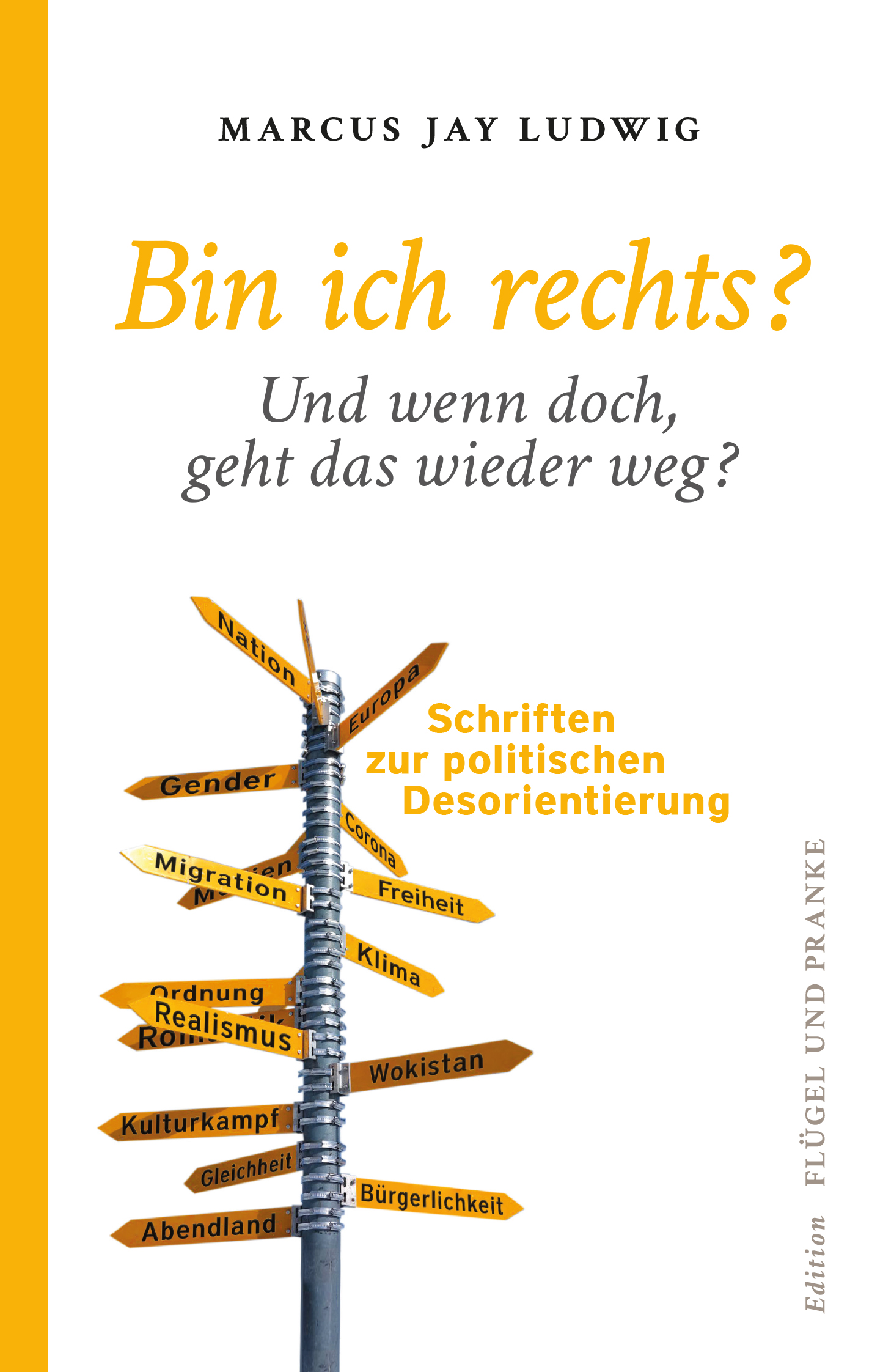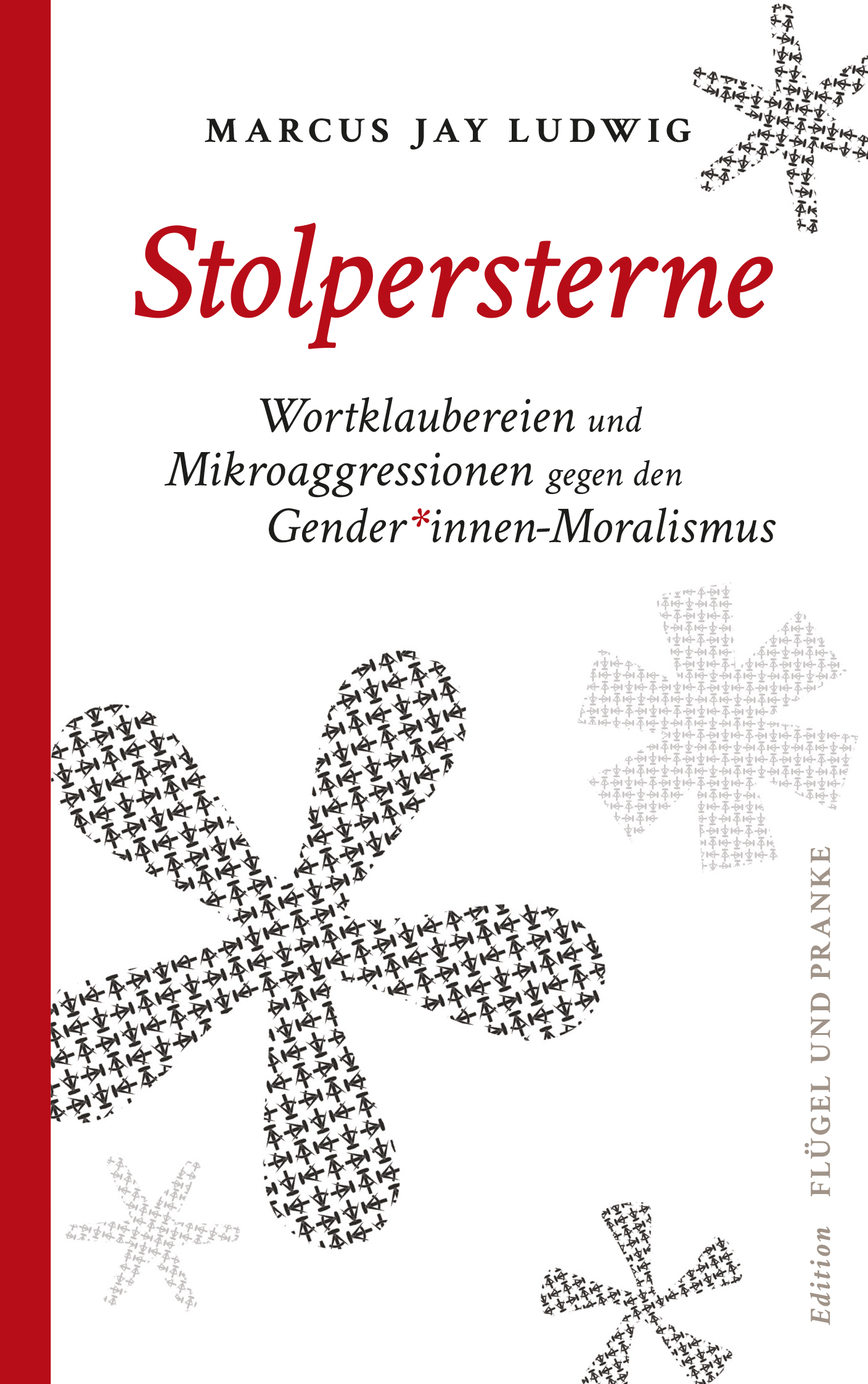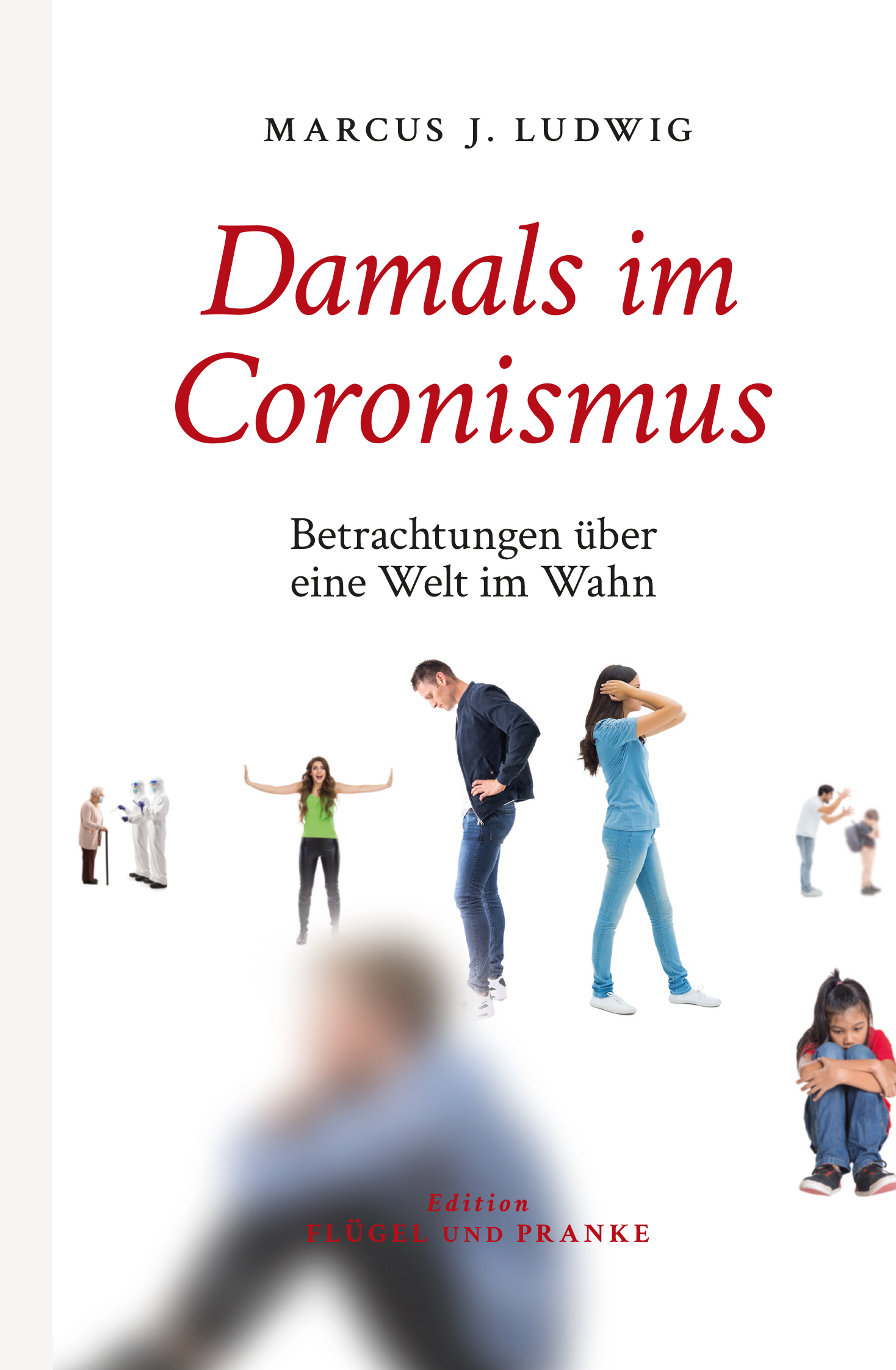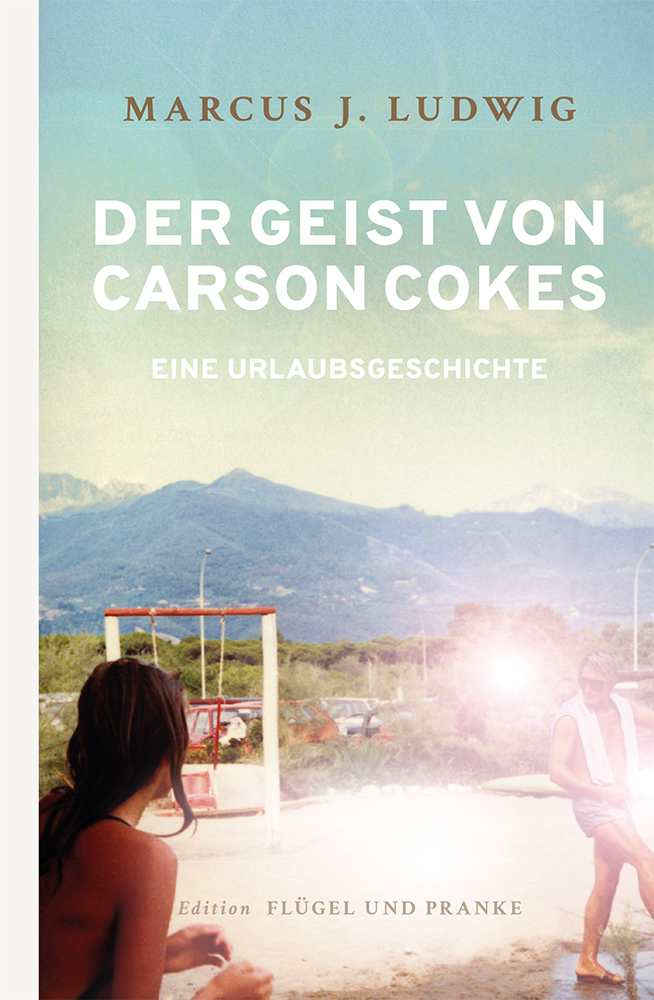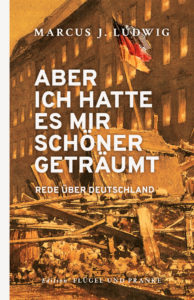Nahezu alles, was Menschen tun, ist erklärungsbedürftig. Kaum etwas, was Menschen unternehmen, denken, fühlen, erleben, würde man – vergleicht man es mit den Verhaltens- und Existenzweisen ihrer nächsten Verwandten: Gorillas, Orangs, Schimpansen, Bonobos – so erwarten. Nichts versteht sich hier von selbst, alles ist seltsam und unnatürlich und in unterschiedlichen Graden grotesk. Konnte der grinsende Affe im Zoo unseren humanistisch überheblichen Ahnen noch als Zerrbild des Menschlichen erscheinen, so wird uns heute zunehmend deutlich, dass wir wohl eher die verzerrten, verfremdeten, aus der Art geschlagenen Karikaturen unserer primatischen Vettern sind.
Nahezu alles, was Menschen tun, erscheint dem bio-logischen Betrachter als gigantische Energieverschwendung. Es muss irgendein unermesslich großes Bedürfnis existieren, das all den Aufwand verständlich machen kann, all die Aufregung, den Ehrgeiz, die Verbissenheit, das Engagement, die Obsessivität, die Homo Sapiens in Ziele und Tätigkeiten investiert, die nichts mit den elementaren Lebensbehaglichkeiten – Geschlechtslust, Essen, Trinken, Schlafen, Spielen – zu tun haben. Lauter Inszenierungen, lauter Auseinandersetzungen, Suchbewegungen, Explorationen, Kämpfe, Grübeleien, Ordnungs-, Regelungs-, Systematisierungs-, Welt- und Selbstvergewisserungstechniken, Anstrengungen, die nur ein Wesen unternimmt, das im Innersten fundamental beunruhigt ist. Ein Wesen, das Sicherheit sucht. Homo Sapiens, der „verständige“ Mensch, ist in Wahrheit vor allem der verunsicherte Mensch. Oder der verängstigte Affe. Eine Frage der Perspektive.
Die Situation des Menschen ist keine. Der Mensch ist gerade nicht „situiert“. Der Mensch, der freie, vielleicht zu freie, seinen Instinkten entfremdete, nackte Affe, der im Grunde nichts kann, außer ein bisschen erkennen, er sitzt nicht auf der Erde, er fällt durch die Welt. Sein tiefstes und dauerndstes Bestreben ist es, Halt zu finden in einer Umwelt. Halt und Stellung und Sitz: Situation. [1]
Diesen Ort der Ansässigkeit, diese irdische Umwelt, in der er endlich seinen Platz und seinen Frieden findet, muss er sich schaffen, physisch und mental. Deshalb schlägt der Mensch Zaunpfähle in den Boden und sagt: Hier sei meine Situation, meine Re-sidenz, hier will ich wieder ein Tier werden, ein in sich ruhender natürlicher Organismus, der nicht hadert mit dem, was nur Menschen – die Metaphysiker unter den Mammalia – kennen und bewohnen zu müssen meinen: die Welt.
Der Mensch schlägt Pfähle in den Boden, dann zäunt und grenzt er sein Grundstück ab gegen das All, um ein Haus, einen Sitz im Leben zu errichten. Für den Bau seines Hauses braucht er ein Gerüst. Und alle Ismen sind Streben dieses Gerüsts.
Ein Gerüst ist ein Provisorium, ein Behelf, solange das eigentliche Haus noch nicht steht. Ein Gerüst braucht, wer im Freiraum oberhalb des festen Bodens operiert. Ein Gerüst bietet Tritt und Halt, aber es reduziert auch die Richtungen und Möglichkeiten, sich durch den Luftraum zu bewegen. Aus Sicht der Kolibris, der Königsweihen und Fledertiere ist ein Gerüst nur eine Art Rollstuhl für Flugbehinderte.
[…]
Den vollständigen Text finden Sie im Buch >> Bin ich rechts? – Und wenn doch, geht das wieder weg?
© Marcus J. Ludwig 2022
Alle Rechte vorbehalten