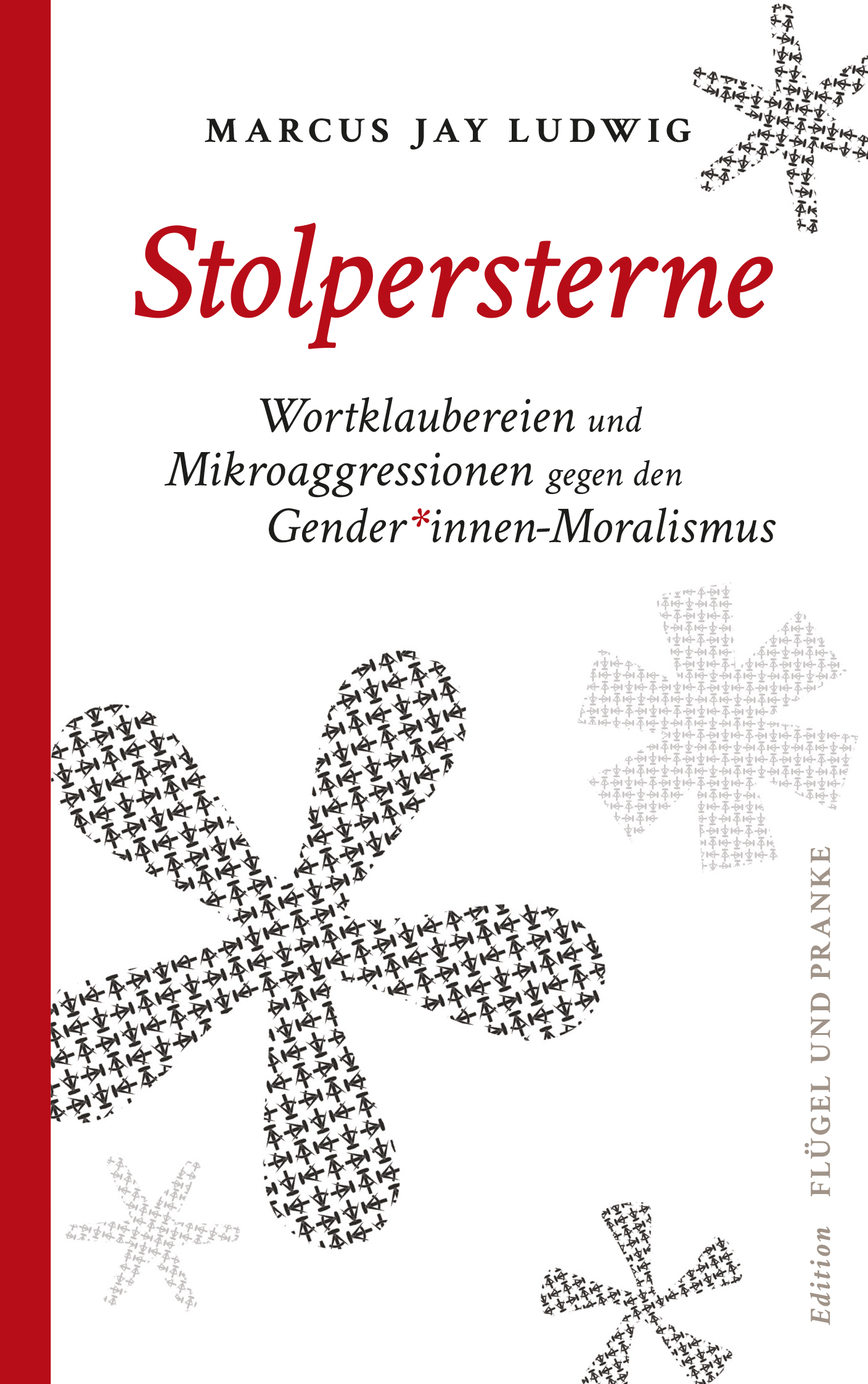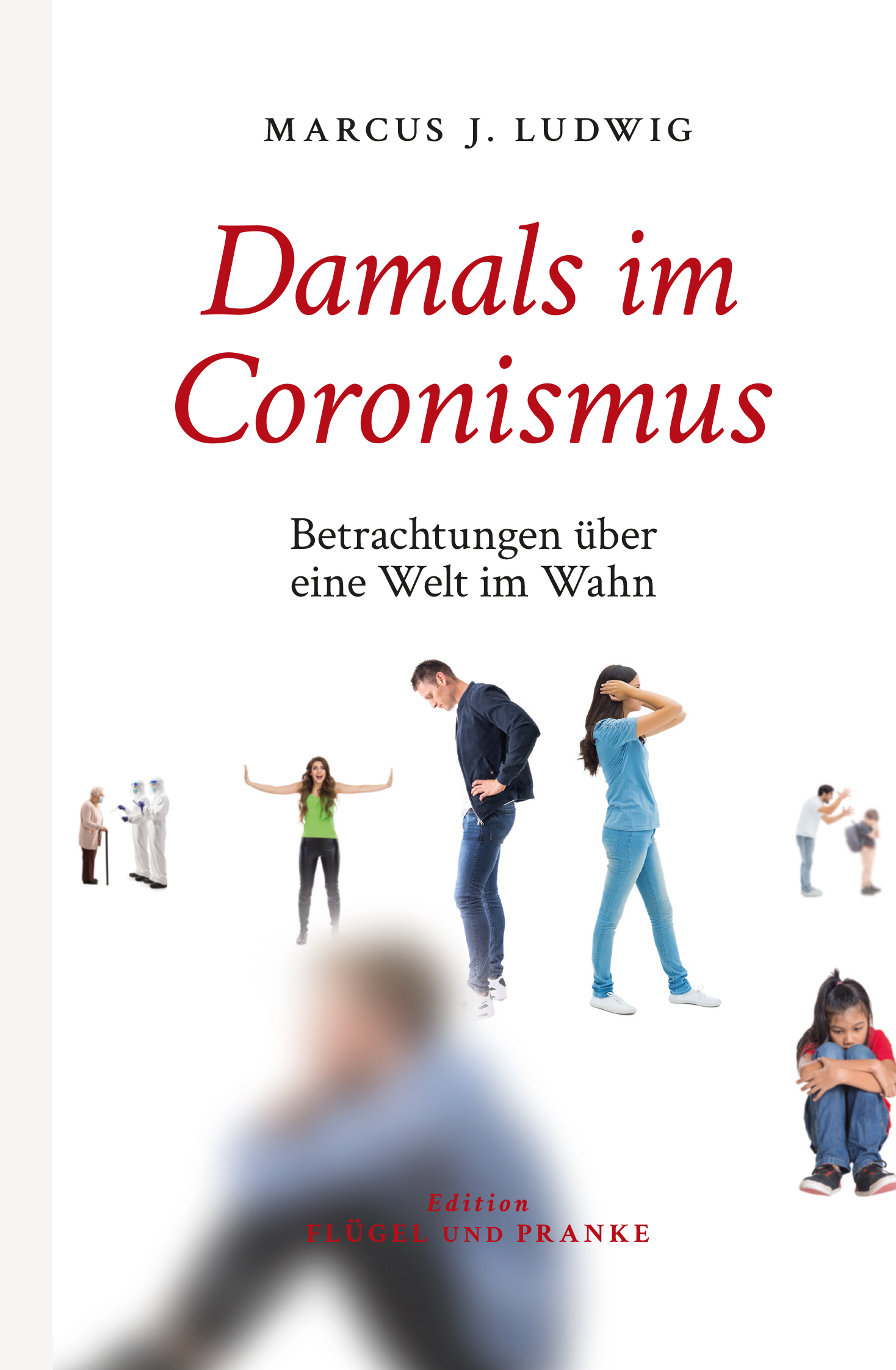Heute vor 35 Jahren erschien „The Queen is dead“. Kein übermäßig runder Anlass, um sich hier weitschweifig über die Smiths auszulassen. Ich tu‘s aber trotzdem.
Es gab bis zur Ausbreitung des Internets noch eine relativ lebendige Romantik, also jetzt nicht so was wie Abendessen bei Kerzenschein oder auf weißen Pferden in Zeitlupe über den Strand reiten, sondern eine echte „kulturgeschichtliche“ Erscheinung und Merkwürdigkeit, eine Geisteshaltung mit allem charakteristischen Zubehör: mit krankhafter Sehnsucht, mit einer diffusen Anfälligkeit für alles Unerreichbare, einem gegenstandslosen Weltschmerz, einer fiebrigen Resignation, einem unstillbaren Verlangen nach Erlösung, einer traurigen, traumverlorenen Einsamkeit an betäubend blühenden Sommerabenden.
Ihren Ausdruck fand diese Romantik in erster Linie in der Musik. Es waren nicht nur schräge Außenseitertypen, die einen Großteil ihrer Jugend damit verbrachten, auf dem Bett zu liegen und die Musik zu hören, die ihnen ihre schmerzlich-schöne Lebensuntauglichkeit, ihre erhabene Ungeliebtheit, ihre kostbare Empfindsamkeit elegisch verhallt spiegelte. Es waren fast alle auf die eine oder andere Weise Außenseiter in den Siebzigern, Achtzigern, Neunzigern, fast alle hatten ihre Beschädigungen und Unvorzeigbarkeiten, oder zumindest konnten sie sie herbeifantasieren und sich innerlich in Posen werfen, mit denen sie sich selbst zu Tränen rührten. Sie hatten kein derart entbehrungsreiches Leben wie ihre Eltern, die in Kriegs- und Nachkriegszeiten hineingewachsen waren, aber die 80er-Welt war auch nicht leicht, sie war vor allem langweilig, sie war klein und eng, und sie wurde kaum interessanter dadurch, dass man mit der Clique, mit fünf, sechs anderen Leuten, die genauso gelangweilt und verwirrt waren, auf Spielplätzen abhing und rauchte.
Die Musik war all diesen fortwährend Fallenden das rettende Netz, das sie auffing in ihrer Sehnsucht, die nicht selten ein theatralisch-tiefempfundenes Verlangen nach dem Ende war. Morrissey sang von den „songs that made you cry and the songs that saved your life“, und er selber hat wohl nicht wenige Songs gesungen, die Leben gerettet haben.
Natürlich gab es belanglose, unromantische, affirmative Gute-Laune-Musik zuhauf: Michael Jackson, Madonna, Huey Lewis, Bangles, Phil Collins, Police, Thompson Twins, Bon Jovi und so weiter. Aber das waren lediglich Nebengeräusche, Begleitmusiken für die selbstverordneten grenzdebilen Augenblicke des Alltags, die es auch mal geben musste. Die lebensentscheidenden Lieder, die für die einen von The Smiths, U2, The Cure, Bruce Springsteen, Depeche Mode, The Church, New Model Army kamen, für andere von R.E.M., Pink Floyd, Janes Addiction, Suzanne Vega, Simple Minds, Stone Roses, Tears for Fears, Talk Talk oder den Pixies waren der Stoff, der das rettende Netz unter dem Dasein bildete.
Indem man so etwas niederschreibt, indem einen das Nennen dieser Namen teils schon recht peinlich berührt, weil man dabei kaum noch auf breiteres Verständnis rechnen darf, wird einem klar, wie vorbei diese Zeit ist. Die taumelnden Kinder von heute werden von einem anderen „Netz“ aufgefangen. Und es ist nicht nur Wortspielerei, wenn man vermutet, dass sie zunehmend schon gar nicht mehr aufgefangen werden müssen, weil sie schon längst gefangen sind, bevor sie Fluchtphantasien entwickeln können, bevor ihnen langweilig und leer und einsam zumute wird. Das Internet mit seinen sozialen Netzwerken, seinen unzähligen Interessantheiten und seinen leistungsfähigen Ablenkungsapps, blockiert das Nachwachsen der wichtigsten Ressource jeder Romantik: der Sehnsucht.
Wir können noch nicht sicher sein, ob wir das – im Ganzen gesehen – begrüßen oder bedauern müssen. Wir werden neue, unromantische Menschen bekommen, Menschen, die eine bestimmte Art von Schönheit nicht mehr werden wahrnehmen können. Und erst recht nicht mehr produzieren können. Menschen ohne einen Sinn für die Herrlichkeit des Unmöglichen, des Unerreichbaren, des Unauffindbaren. Denn dieser Sinn reift nur in der Einsamkeit, in der Stille, in der Verlorenheit. Im Fallen.
* * *
Für die Smiths war ich eigentlich zu jung. So wie ich im Grunde fast immer zu jung war. Wie immer hatte ich den Anfang verpasst und kam erst dazu, als es schon so gut wie vorbei war. Bei den Beatles war es so, die hatten sich ein Jahr vor meiner Geburt aufgelöst. Die Doors hatte ich noch knapper verpasst, zwei Tage vor meiner Ankunft im Dasein war Jim Morrisson in einer Pariser Badewanne gestorben. Bei Abba war ich immerhin rechtzeitig zur letzten Platte in einem Alter, das es mir gestattete, mit meinem ersparten Taschengeld das örtliche Haushaltsgerätefachgeschäft zu betreten und schüchtern nach „The Visitors“ zu fragen. Unter den etwa 20 Platten, die Frau Harkort im Angebot hatte, fand sich das Album tatsächlich, aber ich entdeckte dummerweise auch die aktuelle Platte von „The Teens“. Das Cover von „Explosion“ war für einen Elfjährigen natürlich viel cooler, so mit explodierenden Verstärkern und Zeug, das rumfliegt, und dann konnte ich mich nicht entscheiden. Während ich mit beiden Platten in der Hand eine halbe Stunde lang hin und her überlegte, stand die böse Frau im weißen Kittel die ganze Zeit hinter mir, um aufzupassen, dass ich nichts klaute. Als hätte ich eine Schallplatte, die doppelt so groß war wie ich, unter meinem T-Shirt verstecken können. Blöde Kuh.
Ich nahm dann die Abba-Scheibe. Richtige Entscheidung. Die ist heute immer noch super, während die Teens offenbar doch nicht ganz das Zeug zum Klassiker hatten.
Um die Smiths von Anfang an mitzubekommen, war ich jene zwei, drei Jahre zu jung, die in diesem Alter beinahe zwei, drei Generationen ausmachen. Zwischen 12 und 15 wird so gut wie alles im Leben eines Jungen auf den Kopf gestellt, durcheinandergewirbelt, neu sortiert und beleuchtet, mit neuen Vorzeichen versehen. Das Kind wächst in die Fremde, das Leben wird Zumutung, die Musik muss ersetzen, was die Welt ermangelt, und es mangelt überall.
Jedenfalls stieg ich zur dritten und besten Platte ein, „The Queen ist dead“, und von da an blieb die Musik dieser vielleicht bedeutendsten Band aller Zeiten der ewige akustische Spiegel meines Innern. Meines jugendlichen Innern, muss ich sagen. Denn wenn ich heute in diese Musik hineinblicke, dann sehe ich nicht mehr mich, aber ich sehe noch eine ferne, vergangene Möglichkeit von mir, eine frühere Instanz, über die ich nicht spotten und lachen mag, wie über andere Peinlichkeiten und Jugendsünden. Ich sehe das Ernste und immer noch Anwesende, das tief Überdauernde dieser schwierigen Zeit, den in alle Richtungen reißenden Schmerz und die Ströme von unsäglicher Selbstverachtung, die die Seele empfindsamer Jugend zu allen Zeiten bedrohen, sie an Mauern und Abgründen entlangwälzen, bis man schließlich zerrieben, zerschunden, zerbrochen als Erwachsener im Leben aufwacht, hinreichend abgestorben und frei von Illusionen.
* * *
Der unschätzbare Vorteil, den man als deutschsprachiger Jugendlicher, der mit englischsprachiger Musik aufwächst, hat, liegt darin, dass man gerade so viel von den Texten versteht, dass man sich komplett da hineinprojizieren kann. Wenn ich heute irgendwelche alten Songs neu höre, dann wird mir fast überall klar, dass sie von ganz anderen Dingen handeln, als denen, die ich als Fünfzehnjähriger darin gehört habe. Nicht selten verspotten sie gerade das, was man voller Selbstmitleid und Pathos in ihnen zu hören glaubte.
Insofern ist das, was ich die letzten Tage getan habe, nämlich sämtliche Smiths-Songs in chronologischer Reihenfolge wieder und wieder zu hören, eine nicht nur nostalgische, sondern auch etwas ernüchternde Angelegenheit. Der Sänger Morrissey gefiel sich nicht nur in der Pose des ungeliebten, unliebbaren Außenseiters, sondern ebenso in der seines Lieblingsautors Oscar Wilde, des geistreichen Spötters und sarkastisch-dandyhaften Provokateurs. Von sperrigen Themen wie Monarchie und Zölibat und Vegetarismus verstand ich als deutsches Kleinbürgerkind, als „child from those ugly new houses“ natürlich überhaupt nichts. Für mich reichten einige leuchtende Zeilen eines Liedes, um mir den Rest meiner Wunschbedeutung so darum herumzubauen, dass das Verhältnis von Weltschmerz und Rebellentum, Liebestrauer und Bürgerverachtung meinen kleinen Bedürfnissen entsprach. Bei deutschen Texten ging so was nie, weil man da alles verstand, bei französischen oder italienischen oder kölschen ging es noch weniger, weil man da gar nichts verstand.
Englisch war ideal. Englische Texte waren wie Bilder von Turner, wo man hier und da etwas Gegenständliches erkennt, aber das Ganze bleibt doch auf einem Level abstrakter Wolkigkeit, dass man fast alles darin sehen kann, was man will. Man versteht den Gegenstand, und aus den Wolken formt man sich die eigene Geschichte.
Bei einem Song wie „William, it was really nothing“ kümmerte mich nicht, dass es um die Sinnlosigkeit der Ehe ging. Ich hörte vor allem die Zeile „and everybody‘s got to live their life, and God knows I‘ve got to live mine“, und damit war das Lied ein Lied über mich und meine bedauernswerte Existenz, die von niemandem gesehen wurde, außer vielleicht von „God“, der hoffentlich irgendwann mal Erbarmen mit mir haben würde und mir ein weibliches Wesen zuführen würde. Die Eine und Richtige. Was er dann später auch tat. Er oder der Zufall. Egal, danke auf jeden Fall.
Es kann übrigens auch sein, dass es noch nicht mal die besagte Zeile war, die das Lied zu dem machte, was es für mich war, sondern vor allem die Musik, das fantastische Gitarrenspiel von Johnny Marr, dieses nicht nachzuspielende Picking, das treibende Tempo, die bis dahin nie gehörten Harmoniewechsel, dieser ganze sonnige Sehnsuchtssound, dieses Wunder an Schnellkraft, Kostbarkeit und flirrender Schönheit.
Ich bin – falls ich es nicht schon irgendwo gesagt habe – immer gern bereit, die Schönheit über den Sinn zu stellen, und wenn ich irgendwann mal erfahren sollte, dass Morrissey lauter Beipackzettel oder Kindergartengesprächsprotokolle vorgesungen hat, würde das an meiner Smiths-Liebe überhaupt nichts ändern.
* * *
Take me out tonight / Take me anywhere, I don’t care, I don’t care, I don’t care / And in the darkened underpass I thought „Oh God, my chance has come at last“ / But then a strange fear gripped me and I just couldn’t ask / And if a double-decker bus crashes into us / To die by your side is such a heavenly way to die … There‘s a light that never goes out – der Soundtrack zu all den hundert unerhörten, lächerlichen Verliebtheiten zwischen fünfzehn und zwanzig … all die Ms und As und Ps und Ws, die nie mitbekamen, dass ich existierte, und die bis heute nicht wissen, dass ihr Leben ganz anders hätte verlaufen können, wenn sie mich gesehen hätten, meinen traurigen Blick, der sich schuldig abwenden musste, weil er schon alles wusste von der Liebe und vom Tod. Ich weiß nicht, wie ihre Biographien verlaufen sind, ob meine Anwesenheit eine davon irgendwie episodisch bereichert hätte, weniger „ordinary“ gemacht hätte, oder ob ich auch dort, in diesen fernen Lebenskonjunktiven, nur die Katastrophen angerichtet hätte, die ich dann tatsächlich angerichtet habe.
Aber ich will mich nicht lustig machen über die Schmerzen der Jugend. Natürlich war man ein kompletter Idiot mit siebzehn, abends durch die Straßen zu laufen, hoffend, sie sähe einen aus ihrem Fenster, sähe, wie man herumirrt im Fieber, wie man leidet um sie, um die ganze Welt, die so eingerichtet ist, dass ein armer Junge und ein reiches Mädchen nie zusammenkommen können, ein Aldi-Sonderling und eine Literaturprinzessin, die mit den Lehrern über Thomas Mann redet und über den letzten Premierenabend im Theater. Was war man für ein Depp … aber man war auch interessant und bedeutend in seinem Leid, man war auch Werther und Tonio Kröger und Morrissey, man war der große Antiheld der Liebe, schön aus Schwäche und wert, besungen zu werden als Heros des Losertums, des nie aufzuhebenden Verkanntseins. Aber wie sollten Loser wie wir der Angehimmelten zeigen, wie es um uns steht, wie groß und schön wir im Innern sind, da, wo nur die Lebensmusik die Neugierigen und Besonderen zuweilen hinführt … man musste wohl selbst Musiker werden. Und ich wurde Musiker. Aber es nutzte nicht allzu viel. – Man muss halt schon die richtige Musik machen.
Man muss Chris Martin werden, oder Thomas Mars. Man muss das bunte Leben besingen und preisen, wenigstens momentweise heraufbeschwören und simulieren. Wenn man Morrissey sein will, oder Kurt Cobain, verewigt man das Elend. Man kann aber nicht ewig interessant und verkannt bleiben. Man kann nicht ewig sterben und der Welt ein schlechtes Gewissen machen. Man muss aufhören mit dieser Künstler-Kinderei, es der Welt heimzahlen zu wollen.
* * *
Grauenhaft und tröstlich zugleich ist es, festzustellen, wie einem mit den Jahren alle möglichen Dinge immer weniger ausmachen. Dieser ganze herrlich energieverschwenderische Blödsinn mit der Liebe, mit den Frauen … Ununterbrochen war man verliebt, nachdem man mit dreizehn, vierzehn zum ersten Mal Opfer dieses süßlichen, rauschhaften Schwindels geworden war. Und dann ging das über endlose Jahre so. Immer war man besessen, immer war eines von diesen hundert Mädchen, eine von diesen tausend fernen Frauen der innerste Mittelpunkt der Welt, immer war alles ungewiss und maßlos und unerfüllbar, immer ging man im Dunkeln, unter Sternen spazieren, als Zombie und Junkie um ihr Haus herum, fiebernd unter ihrem Fenster, nirgendwo Kühlung noch Klärung findend. Immer sah man ihre Augen, wenn man die eigenen schloss, immer war die Welt voller stürmisch explodierender Refrains und stäubender Sommerblüten, deren Giftwolken man gierig einatmete, um sich bis in die tiefsten limbischen Hirnregionen zu reizen und zu quälen. Immer waren Weltalle und Ewigkeiten der Maßstab des Empfindens.
Ein Augenblick reichte, um die Seele himmelhoch in Brand zu setzen, man suchte die süßesten Irrtümer, um sich hineinfallen zu lassen, man stand nach irgendeinem Auftritt in irgendeiner Stadthalle nachts auf dem Platze, es war noch warm und lebendig von jungen, leichtsinnigen Menschen, Scherben klirrten, ausgelassenes Gelächter, man rauchte eine mit einem Mädchen, einer jungen Frau, die nun endlich die war, die man immer zu finden gehofft hatte. Hier stand sie, in einem Kleinstädtchen im Schwarzwald, im Vogtland, in der Warburger Börde. Man sah in schwarze Augen, die den Mond und die Glut der Zigarette spiegelten, und sie redete irgendwas, das beinah egal war, etwas über Musik, über das Konzert, über ihre Reise durch Neuseeland. Und man hoffte, dass der Moment kommen würde, bald kommen würde, da sich die Hände finden mussten, und der Moment der Überraschung, wie so ein neuer Mädchenmund schmeckt, wenn er zu dieser Stimme und diesen Augen gehört, ganz anders als alle vorherigen, eine neue Chemie ist in der Welt, während der Boden wankt und der Himmel verglüht und das Leben plötzlich richtig und sinnvoll ist, weil es sich immer schon auf diesen Moment zubewegt hat. – Und ein paar Stunden später graut der Morgen und der Moment ist seit Ewigkeiten vorbei. Und während der Bandbus durch diesige deutsche Landschaften fährt, wird einem immer wahrscheinlicher, dass es wohl Traum und Suff nur war, was diesem knappen Flirt den großen Himmel und die Erlösung hinzugezaubert hat.
Mein Gott, so anstrengend, so unglaublich anstrengend war das früher.
* * *
Eigentlich ist es doch ziemlich peinlich, ein Smiths-Fan zu sein. Die Musik der Smiths ist die Musik der Unpassenden, der „etwas schief ins Leben Gebauten“ (um eine schöne Formel von Peter Rühmkorf – oder war es Ringelnatz? – zu stibitzen).
Ich sah einmal ein Coldplay-Konzert – ich glaube, ich sah schon mehrere, ich glaube, die laufen immer auf 3-Sat, wenn irgendwas Dolles ist, 3. Oktober oder Mariä Himmelfahrt oder Sommersonnenwende. Auf 3-Sat laufen dann immer den ganzen Tag lang Konzerte, und auf Phoenix kommt von morgens bis abends Hitler, oder „die sensationellsten Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts“ oder irgend so was – jedenfalls, was ich sagen wollte: bei den Coldplay-Konzerten sieht man grundsätzlich nur schöne Menschen im Publikum, vor allem die Frauen – nur Törtchen vom Allerfeinsten. Bei den Smiths sah man immer nur verdruckste Poeten und Versager. Ich bin sicher: Wenn nach einem Meteoriteneinschlag – durch welchen Zufall auch immer – nur hundert Coldplay-Frauen und hundert Smiths-Männer überleben sollten, würde die Menschheit aussterben, sie würden in tausend Jahren nicht zusammenfinden. Die Typen würden um die Mädels herumschleichen, und statt sie anzusprechen und ihnen an die Wäsche zu gehen nur ihre Versager-Lieder summen. „Last night I dreamt, that somebody loved me“. Und die Umschlichenen würden nur hier und da einen Luftzug verspüren und sich wundern, dass kein einziger Mann auf Erden zu finden ist … „ach“, würden sie seufzen, „hätte doch wenigstens Chris Martin, der Coldplay-Sänger, überlebt, er hätte uns hundert Frauen nach und nach euphorisieren und begatten können und eine neue positive, buntleuchtende, hymnenschmetternde Menschheit ins Leben rufen können, aber es ist ja niemand da zum Zeugen und Leuchten und Singen, nur diese nervigen Schatten und summenden Luftzüge, diese kopfhängenden Schemen von Morrissey-Lookalikes.“
Nein, die Smiths sind wahrlich keine Band für Aufreißer und Sportskanonen. Ich mein, man sehe sich diese vier Typen nur an: irgendwie doch totale Assels, voll Realschule, voll Unterschicht, höchstens Kleinbürgertum, ganz sicher keine Künstlertypen und Literaten, und dann noch nicht mal cool und hemdsärmlig oder wenigstens so richtig unmöglich und aggro, sondern gefühlvoll und höflich, pathetisch-ironisch, extrem angeschwuchtelt, blumenschwenkend; vor Sehnsucht und Weltschmerz triefende, sentimentalisch-genialische, nordenglische Prolls.
Aber was für Musiker, was für übernatürliche Gitarren, was für melodische, herzrhythmische Basswunder, und was für eine singuläre, was für eine durchscheinend-sylphidische Schmerzensstimme – wenn sie nicht gerade jault wie ein hysterischer Tukan. Und was für Texte. „On the high-rise estate / What‘s at the back of your mind? / Oh, a three-day debate / On a high-rise estate / What‘s at the back of your mind? / Two icy-cold hands conducting the way / It‘s the Eskimo blood in my veins / Amid concrete and clay / And general decay / Nature must still find a way / So ignore all the codes of the day / Let your juvenile impulses sway / This way and that way / This way and that way / God, how sex implores you / To let yourself lose yourself / Stretch out and wait / Stretch out and wait / Oh … let your puny body lie down, lie down …“
Ach komm, scheiß auf die Coldplay-Weiber.
* * *
Die Smiths waren nur ganze vier Jahre zusammen. Das reicht heutigen Bands für gerade mal eine Platte. Johnny Marr, Andy Rourke, Mike Joyce und Steven Patrick Morrissey schufen immerhin – wenn ich richtig gezählt habe – 72 Songs, ein paar wenige davon belanglos, die meisten aber mit Ewigkeitsgarantie.
1987 war Schluss. Und Morrissey ist seit nunmehr 34 Jahren solo unterwegs, ohne die Smiths. Er hat großartige Songs eingespielt, keine Frage, viel Müll leider auch, keine Frage. Unterm Strich war es sicher richtig, weiter Musik zu machen, statt sich nach dem Ende der Band im Alter von 28 Jahren schon in die Legendenhaftigkeit zurückzuziehen.
Aber es war doch letztlich alles nur noch Anhang und Nachspiel, es ist nicht das Eigentliche. Es hat etwas zutiefst Falsches an sich, dass dieser Sänger ohne die drei anderen noch immer Musik macht. Zumal sie gerade mit ihrem letzten Album „Strangeways, here we come“ erst ihr eigentliches Niveau erreicht hatten, handwerklich und vor allem soundtechnisch. Sie waren mit dem Klang ihrer Aufnahmen nie wirklich zufrieden, und das völlig zu Recht. Die Schönheit der Songs steht tatsächlich häufig in schmerzhaftem Kontrast zu der Amateurhaftigkeit der Aufnahmen und leider auch der Performance. Der Gesang ist zuweilen entsetzlich schief, die Tracks sind schlecht abgemischt, matschig, proportionslos, bessere Demotapes höchstens. Zuletzt, auf „Strangeways“, klingen sie hingegen erstmals so, wie sie sollen. Es hätten von da aus gut und gerne noch zwanzig weitere Smiths-Alben folgen können.
Warum konnten U2, REM, Depeche Mode Jahrzehnte zusammenbleiben, aber die Herren Marr, Rourke, Joyce und Morrissey mussten sich nach vier Jahren überwerfen? Und sich dann auch noch um Kohle streiten …
Aber wollte ich nicht eigentlich über die Platte schreiben, über „The Queen ist dead“? Ja, wollte ich, nur: was gibt es da eigentlich groß zu schreiben … sehr wahrscheinlich wird niemand, der die Songs nicht von Jugend auf kennt, damit nachträglich viel anfangen können. Es ist Jugendmusik, Morrissey ist der Sänger für schwierige Heranwachsende, so wie Herrmann Hesse der ewige Dichter der romantisch-sinnsuchenden Jugend ist. Mit 50 oder 60 noch mit so was anzufangen, hat wohl keinen Zweck.
Ich vermute mal, dass relativ wenige Vierzehn- und Fünfzehnjährige meine Blog-Texte lesen. Falls doch, dann – ihr Ärmsten – besorgt euch sofort „The Queen ist dead“, ach was, besorgt euch die kompletten Smiths, und dann lernt euch lieben, lernt euch langweilen, euch betrauern und bedauern, euch bewundern und euch sehnen. Warum auch immer … es muss wohl Menschen wie euch geben, damit die angepassten Konformisten-Kinder, die elenden Zeitgeist-Streber und Jungtotalitaristen diese Welt nicht völlig verschandeln und unbewohnbar machen.
Und da ihr euch ja – soweit ich weiß – keine Platten oder CDs oder MP3-Dateien mehr kauft, sondern nur noch Playlists zusammenstellt, liefere ich euch hier noch die ultimative Smiths-Playlist. Vertraut mir, ich weiß, was gut für euch ist. Gut, wenn auch gefährlich.
Back to the Old House
William, It Was Really Nothing
Please, Please, Please, Let Me Get What I Want
How Soon Is Now?
The Headmaster Ritual
That Joke Isn’t Funny Anymore
Meat Is Murder
Stretch Out and Wait
The Queen Is Dead
Frankly, Mr Shankly
Cemetry Gates
Bigmouth Strikes Again
The Boy with the Thorn in His Side
There Is a Light That Never Goes Out
Some Girls Are Bigger Than Others
Unloveable
Panic
Ask
Half a Person
Girlfriend in a Coma
A Rush and a Push and the Land Is Ours
Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me
Unhappy Birthday
Paint a Vulgar Picture
Wenn Ihnen dieser Text gefällt oder sonstwie lesenswert und diskussionswürdig erscheint, können Sie ihn gern online teilen und verbreiten. Wenn Sie möchten, dass dieser Blog als kostenloses und werbefreies Angebot weiter existiert, dann empfehlen Sie die Seite weiter. Und gönnen Sie sich hin und wieder ein Buch aus dem Hause Flügel und Pranke.
© Marcus J. Ludwig 2021.
Alle Rechte vorbehalten.