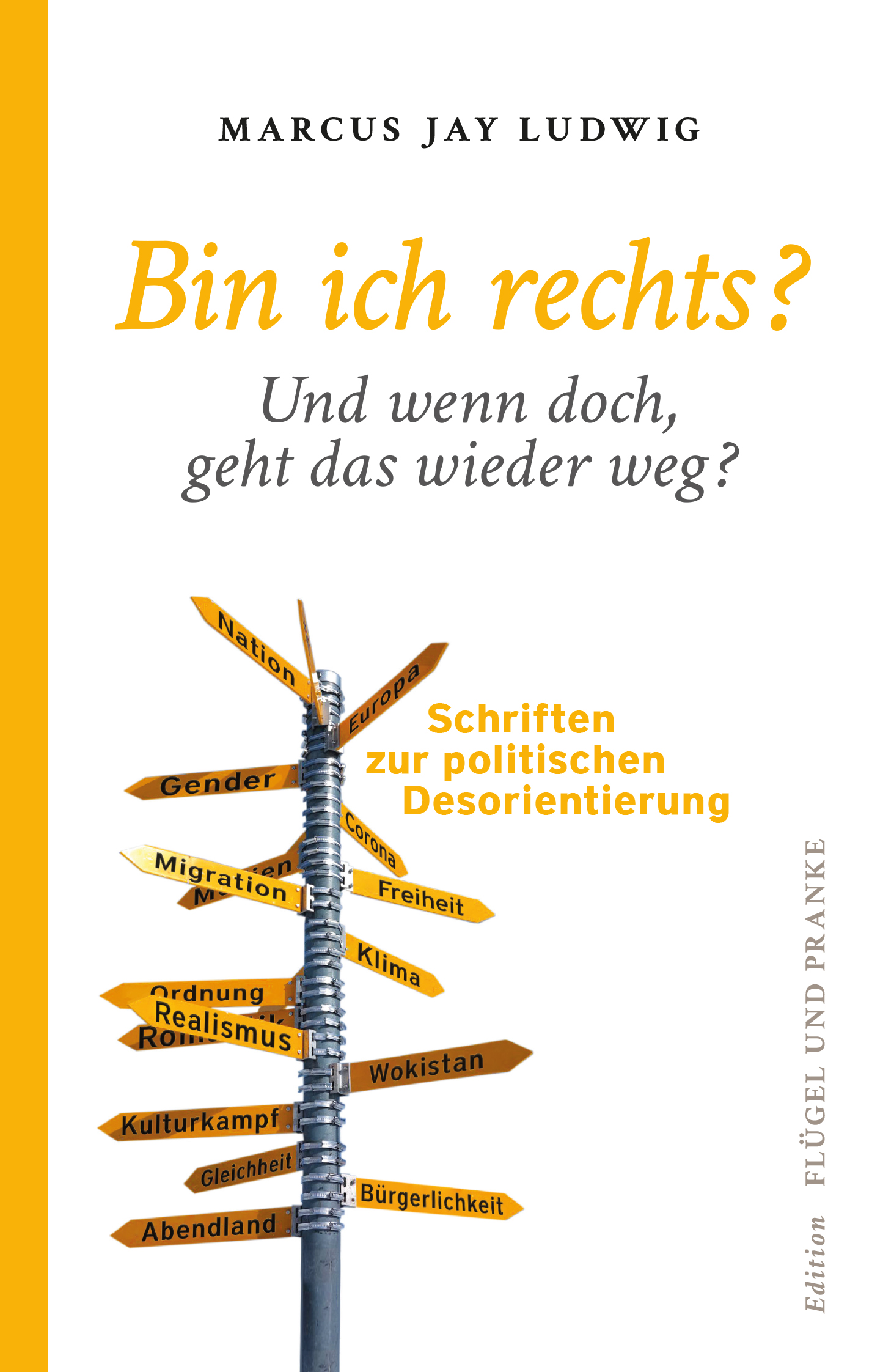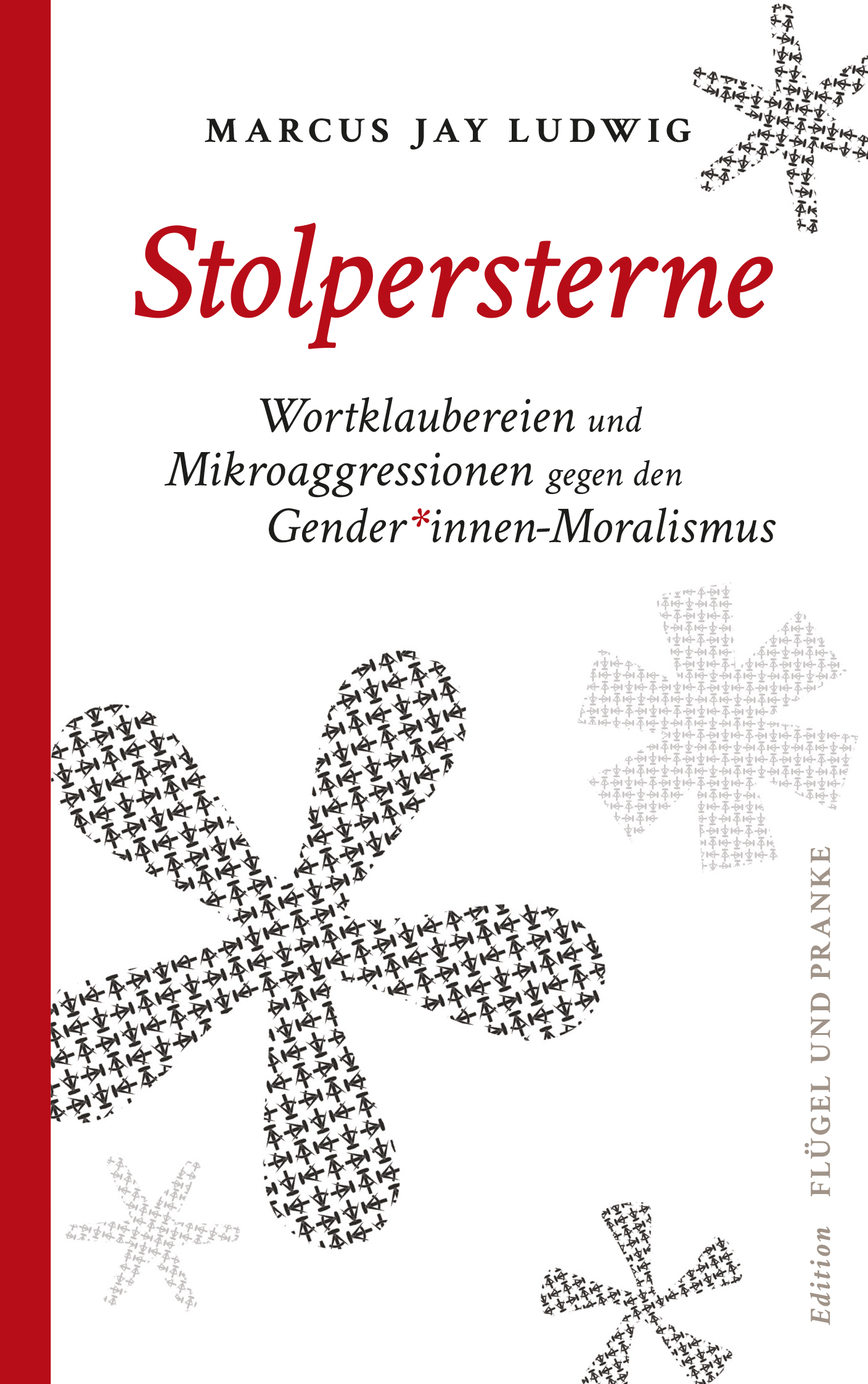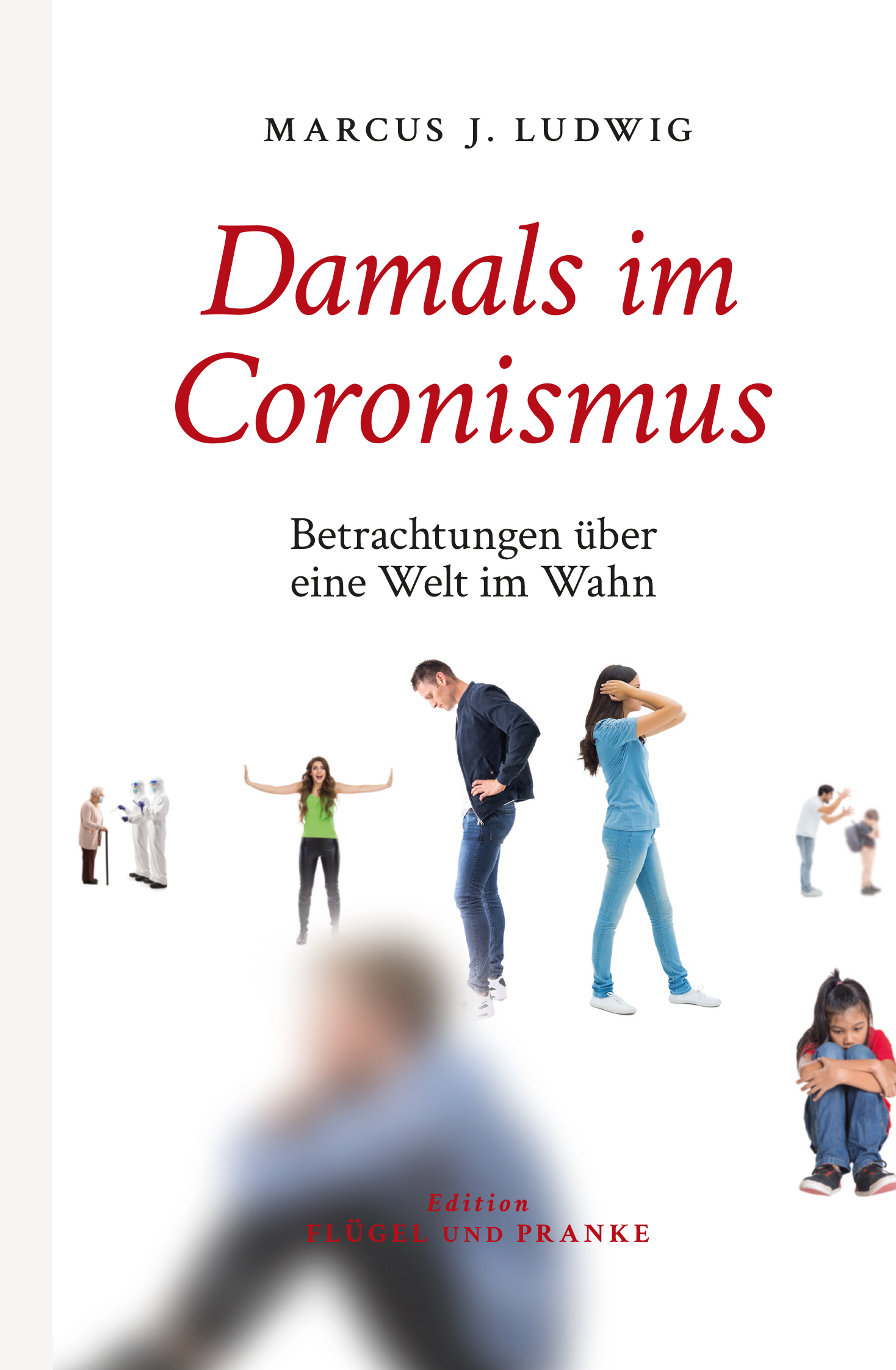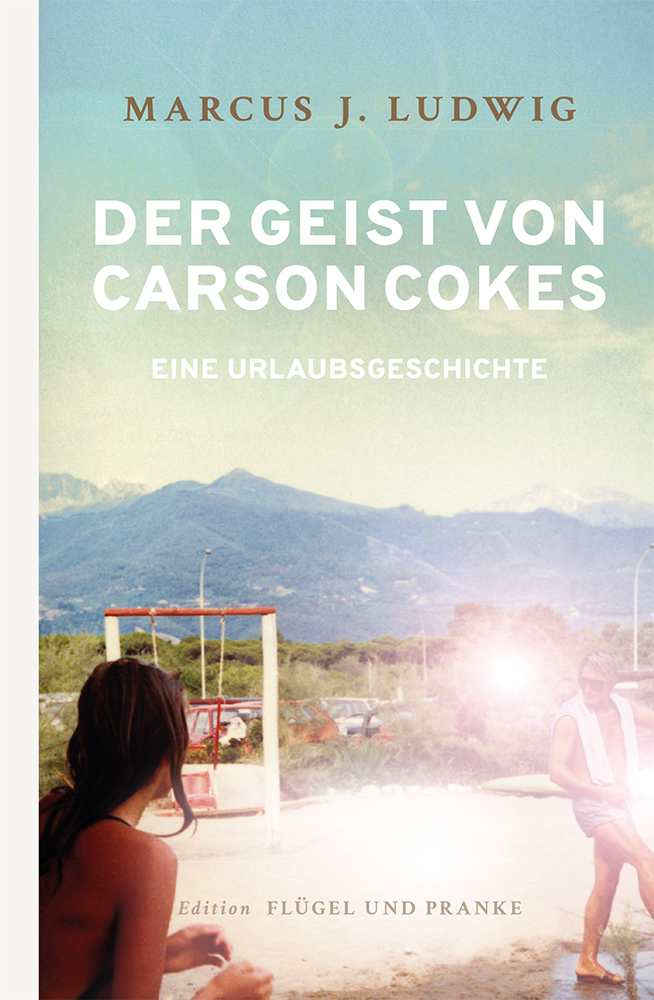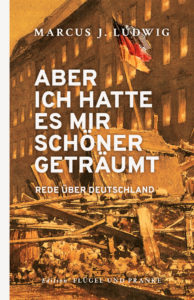(Auszüge)
Den vollständigen Essay finden Sie im Buch >> Stolpersterne
– – –
Ich gehöre nicht zu denen, die angesichts nervtötender Doppelformen, Asterisken und Binnenmajuskeln von „Gender-Gaga“ sprechen. Das klingt mir irgendwie zu augenrollend, so als hätten wir es mit kapriziösen Überspanntheiten zu tun, mit den Allüren einer Diva, einem grotesken Hutschmuck etwa, mit dem man durch keine Autotür passt. Nein, „Gaga“ trifft es nicht. Der adäquate Terminus – meines Wissens von Monika Maron im Roman „Munin“ eingeführt – lautet „Gender-Scheiße“. Damit ist die Sache im Grunde auch schon hinreichend erörtert.
Da aber Fäkalsprache in manchen Kontexten als unterschwellig aggressiv empfunden wird und zu raschen Gesprächsabbrüchen führen kann, rate ich eher dazu, sich des ebenso treffenden, dafür aber wesentlich konzilianteren Ausdrucks „Gender-Unfug“ zu bedienen. „Unfug“ bezeichnet eine Sache, die „ungefüge“ ist, ein schiefes, wackeliges Unding, an dem nichts zusammenpasst … eine geistige Fehlkonstruktion.
Konstruktion – gutes Stichwort, denn damit sind wir schon beim Kern der Misere: Der Gender-Unfug beruht, wie manch anderer Unfug der Gegenwart, auf der Weltanschauung des Konstruktivismus. Also der gerade wieder sehr modischen Vorstellung (man könnte sie auch „Vulgär-Indeterminismus“ nennen), dass es nichts Menschliches „von Natur aus“ gebe, dass vielmehr jedes neue Menschenkind ein unbeschriebenes Blatt sei, oder besser: ein ungeformter Klumpen sozialer Materie, der nach Belieben geformt, designt, gestaltet werden kann. Beklagenswert dünkt es die Konstruktivisten nur, dass die Menschen meist nicht nach ihrem, also der Konstruktivisten Belieben geformt werden, sondern nach den bestehenden Machtverhältnissen, die immer noch dafür sorgen, dass Neugeborene mit Penis einen blauen statt einen rosa Strampelanzug angezogen bekommen, dass sie, kaum aus dem Uterus geflutscht, schon Autos als Spielzeuge erhalten, wodurch sie zu Technikern prädestiniert werden, die dann später all die Autokonzerne beherrschen, wo die Frauen dann keinen Platz am Vorstandstisch bekommen, weil das Patriarchat ihnen nur blöde blonde Barbies zum Spielen gab und sie nur Psychologie und Hauswirtschaftslehre studieren ließ.
Von Watson geradewegs zu Will
Der derzeitige Sozialkonstruktivismus ist die zur Arroganz, ja, zur Militanz gesteigerte Weiterentwicklung der behavioristischen Milieutheorie: Es gibt nichts Angeborenes, keine Stammesgeschichte, der Mensch ist kein Teil der Natur, er ist nicht abhängig von seinem Körper, weder von seinen Geschlechtsorganen, noch von seinen Hormonen, noch von seinen Genen. „Gebt mir ein Dutzend wohlgeformter, gesunder Kinder und meine eigene, von mir entworfene Welt, in der ich sie großziehen kann und ich garantiere euch, dass ich jeden […] so trainieren kann, dass aus ihm jede beliebige Art von Spezialist wird – ein Arzt, ein Rechtsanwalt, ein Kaufmann und, ja, sogar ein Bettler und Dieb, ganz unabhängig von seinen Talenten, Neigungen, Tendenzen, Fähigkeiten, Begabungen und der Rasse seiner Vorfahren“. So John Broadus Watson im Jahre 1913.
Von da führt eine gerade Linie zu den geschlechtergerechten Gehirnwäschern, die im Radio von „Schüler Innen“ und „Wissenschaftler Innen“ reden. Wenn – so meinen sie – die Welt ohnehin immer schon Konstruktion ist, wenn die Menschen samt ihrer Wirklichkeit eh „gemacht“ werden, dann sollten wir sie nicht länger von den Falschen, von den Bösen, also von den Männern, den weißen, christlichen, europäischen Vergewaltigern, Sklavenhaltern und Völkermördern machen lassen, dann machen wir sie jetzt besser selber.
Jetzt – der Zeitpunkt ist tatsächlich so günstig wie nie: Die Nachfahren der Achtundsechziger haben den Marsch durch die Institutionen weitgehend absolviert, an allen Hebeln sitzen grün grundierte Lifestyle-Linke, bestens Etablierte, die innerlich imprägniert sind mit jenen Philosophemen, die ihre Eltern in den Wohnküchen der 70er Jahre zwischen Joint und Flockenquetsche durchdiskutierten. Die Kinder und Schüler der quetschenden Küchenphilosophen sind heute Bürgermeister und Chefredakteusen, und sie exekutieren jetzt ganz freiwillig all das, was die idealistischen Kiffer sich damals erträumten: sie befreien die Menschen aus all den tradierten Zwangsstrukturen und Machtverhältnissen, indem sie mit aller Macht das große Befreiungsglück herbei…, nun ja, herbeizwingen. Ganz ohne Zwang geht es halt nicht, aber diesmal ist es ja für die fraglos gute Sache.
[…]
Männer und Weiber und Sachen?
Das grammatische Geschlecht, das Genus, bildet im Deutschen drei Nominalklassen, also Klassen von Hauptwörtern, die eben durch ihr Genus Dinge und Wesen klassifizieren. Sehr einfach eigentlich, aber in sich leider total unlogisch. Kompliziert und verwirrend wird es schon dadurch, dass die Rede vom grammatischen „Geschlecht“ den Gedanken an etwas Sexuelles nahelegt, „Genus“ bedeutet aber „Geschlecht“ eher im Sinne von „Gattung“, „Familie“, also etwa so wie beim „Adelsgeschlecht“, womit bekanntlich nicht das Fortpflanzungsorgan irgendeines Grafen gemeint ist.
Gruppen, die durch Verwandtschaftsverhältnisse definiert sind, haben zwar letztlich doch wieder was mit Sexualität zu tun, denn die Verwandtschaft kommt nun mal durch Sex zustande, aber darum geht es beim grammatischen Genus nicht. Spätestens, wenn wir vom „Neutrum“ reden, vom „sächlichen Geschlecht“, müsste das eigentlich klarwerden. „Das Kind“, „das Männchen“, „das Weibchen“, sind offensichtlich keine „neutralen“ Sachen. Die Vorstellung, die Sprache müsste die reale sexuelle Beschaffenheit von Lebewesen benennen, zeugt von sonderbarer linguistischer Naivität. Diese wird man dem Normal-User nicht vorwerfen, wohl aber Leuten, die sich anmaßen, den Sprachgebrauch neu und sogar „gerecht“ justieren zu können.
Die hauptsächliche Komplikation liegt nun darin, dass der Zusammenhang von Genus und Sexus zwar nicht völlig arbiträr ist, sondern oft, vor allem eben bei menschlichen Lebewesen, tatsächlich linguistisch-biologische Kongruenz aufweist (der Mann, die Frau, der Herr, die Dame, der Kerl, die Tussi), dass die realen Dinge dem grammatischen Geschlecht aber doch mengenmäßig zu häufig, als dass man diese Fälle durch ein paar wenige Eingriffe in die Sprache korrigieren könnte, nicht entsprechen – allein deshalb, weil sie, wenn keine Lebewesen, gar kein reales Geschlecht besitzen (der Wagen, die Karre, der Stuhl, die Couch, der Himmel, die Luft). Die Eingriffe müssten massiv sein, man müsste eine ganz neue Sprache konstruieren. Wenn man das aber wirklich tun wollte – müsste man sie dann zuvörderst geschlechtergerecht, oder nicht einfach realitätsgerecht konstruieren?
Wir sprechen gewohnheitsmäßig Deutsch. Das Hineingewachsensein in die Strukturen unseres Sprechens und damit auch des Denkens, legt uns nahe, drängt uns geradezu auf, die Welt in männlich, weiblich, sächlich einzuteilen. Aber wenn man eine neue Sprache ersinnen wollte, würde man das gewiss etwas anders handhaben.
Männlich, weiblich, sächlich – das ist, recht besehen, keine allzu sinnvolle Klassifikation. Welche Realität bildet diese Dreiheit ab? Wenn ich die Welt anschaue, sehe ich dann überall Männer und Weiber und Sachen? Man könnte doch vielleicht ebenso gut oder besser zwischen belebt und unbelebt unterscheiden. Dann gäbe es zwei Genera, die durch Artikel und Endungen irgendwie zu kennzeichnen wären.
Man könnte natürlich die Männlich-Weiblich-Dichotomie beibehalten, aber dann wären Kinder doch ganz offensichtlich nicht sächlich. Man müsste dann also vier Genera einführen: männlicher Erwachsener, weibliche Erwachsene, männliches Kind, weibliches Kind. Das wäre einigermaßen sinnvoll. Und zudem könnte man ein Genus, also eine Gattung von Nomen, für Tiere ersinnen, dann noch ein Genus für Pflanzen, eines für technische Dinge, eines für Mineralien, eines für Abstrakta, und so weiter.
Und in der Tat gibt es Sprachen (Bantusprachen im mittleren und südlichen Afrika etwa), die viel mehr Nominalklassen kennen als wir mit unseren drei Genera im Deutschen. Sie unterscheiden zum Beispiel auch noch nach „natürlich“ und „vom Menschen hergestellt“, „klein“ und „groß“ oder „essbar“ und „nicht essbar“. Andere, wie das Englische, haben die Nominalklassen weitgehend abgeschafft. Es hing wohl, historisch gesehen, davon ab, wie wichtig bestimmte Unterscheidungen von Aspekten der Lebenswelt für die Mitglieder der Sprachgemeinschaft waren. Für manche Kulturen war es offenbar wichtiger, die Unterschiede zwischen Früchten und Steinen grammatisch zum Ausdruck zubringen, als die Unterschiede zwischen Menschen mit Penis und solchen ohne.
[…]
Als nächstes kommt das zwanghafte Umschiffen der „kritischen“ Nomina mithilfe substantivierter Partizipien: Studierende statt Studenten, Lehrende statt Lehrer, Lotsende statt Lotsen, Forschende, Gebärende, Arbeitende, Kulturschaffende, Volksvertretende, Gehirnwaschende, Unfugtreibende.
Damit verkürzt man zwar stressige Doppelformen wie „Studenten und Studentinnen“, „Möbelpacker und Möbelpackerinnen“ etc., aber um den Preis der unfreiwilligen Komik. Wobei es sich allerdings vielleicht auch nur um eine Frage der Gewöhnung handelt, und die generelle Partizipablehnung insofern als konservativer Starrsinn abgetan werden könnte.
Der genuin linguistische Einwand bezieht sich daher weniger auf die Albernheit als auf die totale semantische Ignoranz, die solchen Bildungen innewohnt: Man ersetzt einen Gattungsnamen, der auf ein geistiges Konzept referiert, durch eine nichtssagende Verlaufsform und erzeugt damit eine flüchtige Präsenz, wo vorher personale Stabilität war.
Das Wort „Lehrer“ mag ebenso wie „Lehrender“ jemanden bezeichnen, der lehrt, also ebenfalls der Form nach ein substantiviertes Verb sein, aber dieser verbale Charakter ist aus der Semantik längst entwichen. Der Lehrer ist nicht einer, der gerade eben etwas tut, sondern jemand, der dauerhaft etwas ist, und im Idealfall ist er es mit Leib und Seele. Ein Lehrender dagegen ist Funktionär einer Anstalt, in der gerade Unterricht stattfindet. Er tut etwas, und wenn er es getan hat, dann ist er kein Lehrender mehr, sondern ein Nachhausegehender und Mittagessender. Ein Lehrer bleibt Lehrer, egal was er gerade tut. Er bleibt es, wenn er ein echter Lehrer ist, sogar nach seiner Pensionierung.
Noch deutlicher wird das Ganze beim Arzt (und bei der Ärztin), wo das mit dem Partizip zum Glück auch schwieriger ist. Ein Arzt ist ein mit seinem Beruf – mit seiner Berufung – im Kern seines Wesens identifizierter Mensch. „Ich bin Arzt“, das sagt man mit Stolz und Selbstbewusstheit, im unsympathischeren Fall auch mit Standesdünkel. Jedenfalls sagt man es anders als man sagt „ich bin Patientenbehandelnder“, „ich bin Sprechstundeabhaltender“, „ich bin Hausarztleistungenerbringender“. Und vor allem meint man es anders. Aber gerade dieses Meinen, dieses tiefere semantische Empfinden zu verändern, ist ja das Kernanliegen der Gender-Utopisten. Sie wollen keine gefestigten Menschen, die sich ihrer Identität sicher sind, und das womöglich lebenslang. Sie wollen fluide Augenblickswesen, die sich jeden Tag neu erfinden und aushandeln. Und ich habe echt keine Ahnung, warum sie das wollen.
[…]
Den vollständigen Essay finden Sie im Buch >> Stolpersterne
© Marcus J. Ludwig 2021.
Alle Rechte vorbehalten.