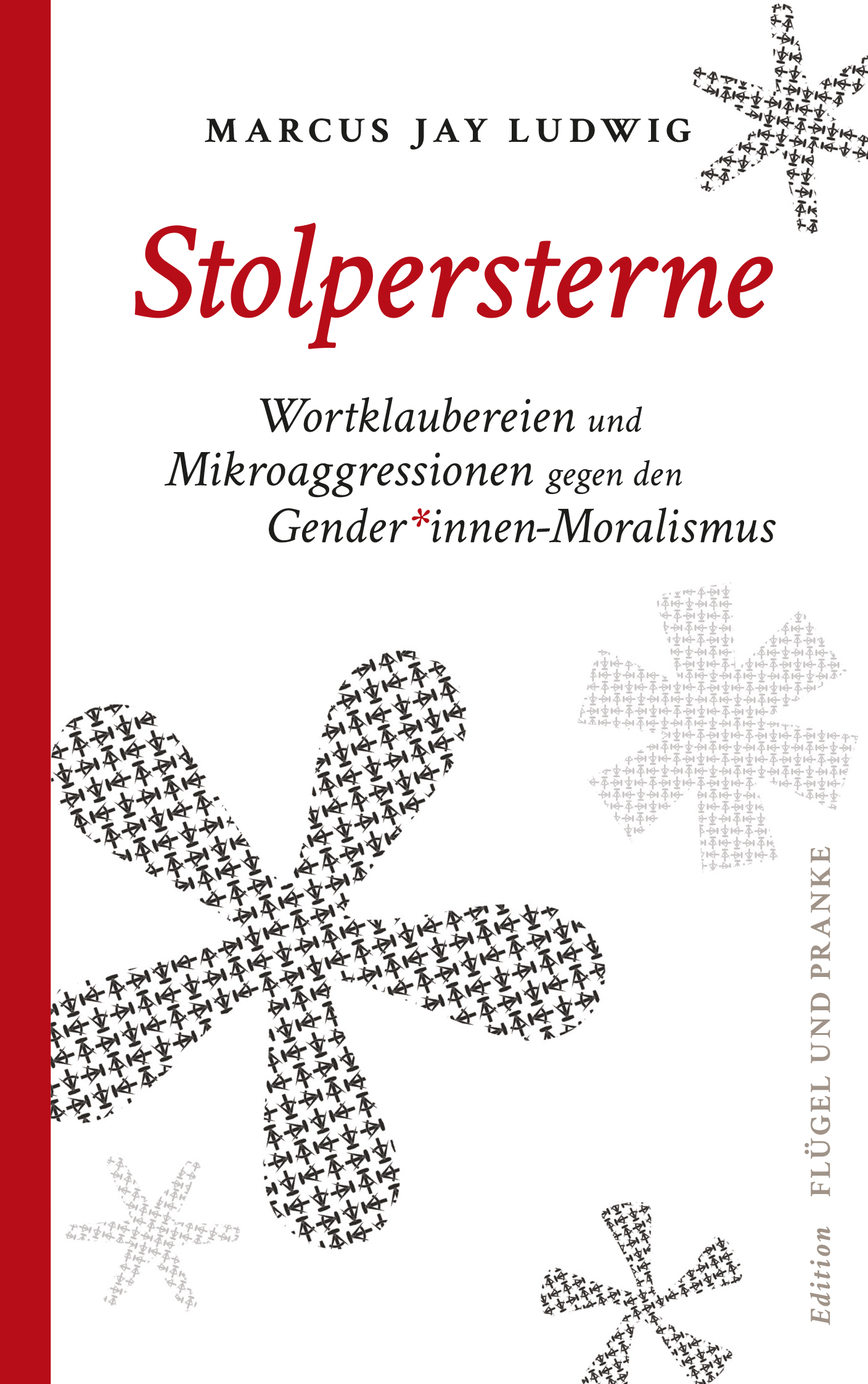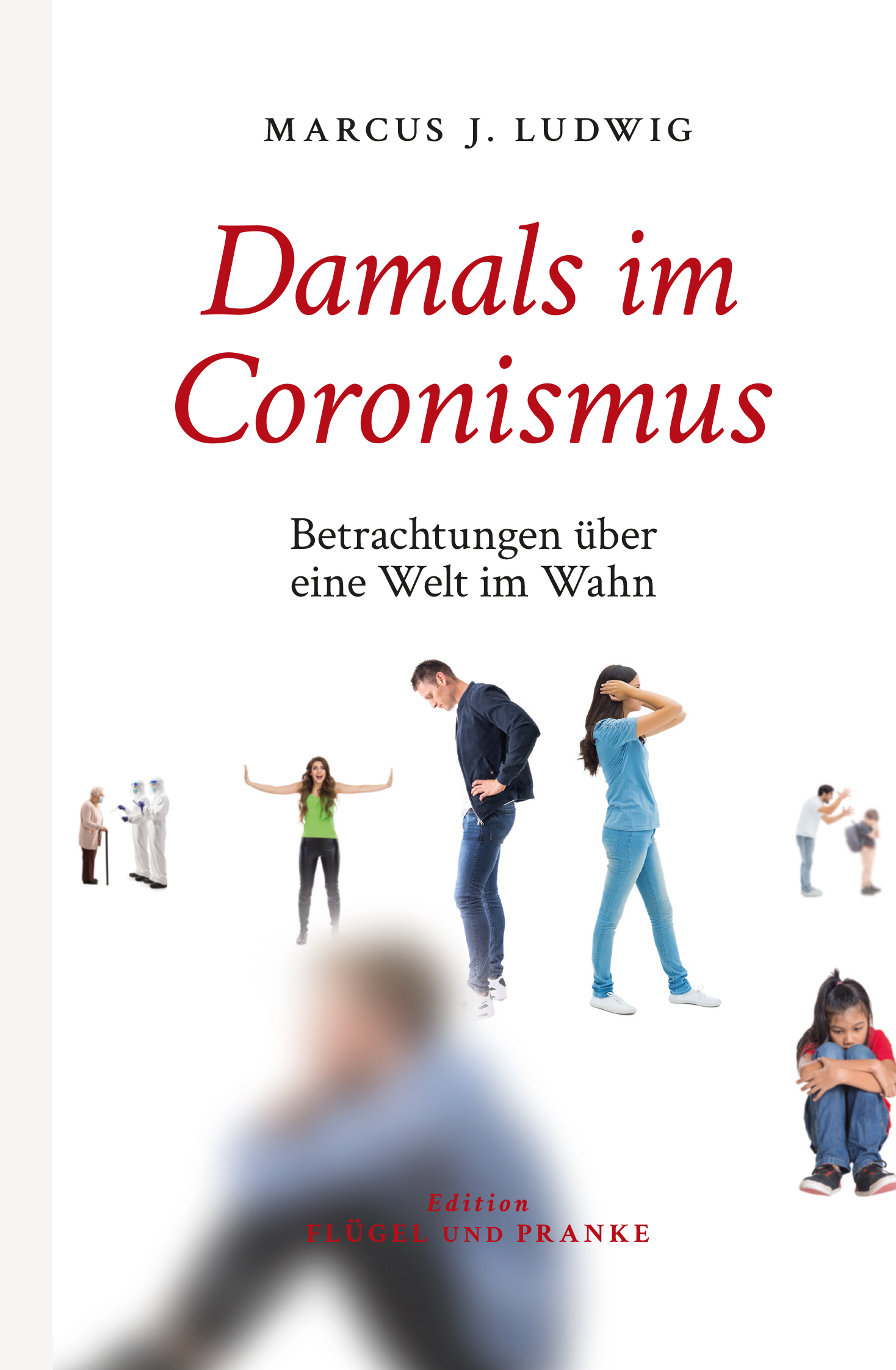(Auszüge)
Den vollständigen Essay finden Sie im Buch >> Stolpersterne
– – –
Die Gendersprache ist auf dem Vormarsch. Wir erleben einen naturrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den freien Menschen, und die Truppen des Aggressors stehen bereits tief im Usuell-Unbewussten einer kaum noch abwehrbereiten deutschen Sprachgemeinschaft.
Wer ist der Aggressor? Es ist der linke Konstruktivismus, jene illiberale, moralistische Machbarkeitslehre, die immer und immer wieder, in jeder Epoche aufs Neue, die Gute Gesellschaft und den Neuen Menschen erzwingen will. Zumindest für Letzteren stehen die Realisierungschancen diesmal womöglich gar nicht so schlecht. Ob dieser umprogrammierte Primat dann noch das Prädikat „Mensch“ verdient, ist allerdings die Frage …
„Bürgerinnen und Bürger“, „Christinnen und Christen“, „Spitzensportlerinnen und Spitzensportler“ – immer mehr Deutsche (und Deutschinnen) reden so, die Dimorphie als sprachlicher Tugendnachweis setzt sich durch, selbst der von aller akademischen Sensibilisierung unversehrte Ostkurvenproll versucht sich schon hier und da – zumindest vor Kameras – im gerechten Sprechen.
In den Empfehlungen und Verordnungen der Sender, Behörden, Universitäten wird diese antidiskriminatorische Redensartlichkeit zuweilen mit gutmütigem Unterton als „Paarform“ bezeichnet. Als ich vor dreißig Jahren auf dem Weg war, der Sprachwissenschaftler zu werden, der ich dann doch nicht wurde, sprach man in Fachkreisen treffender von „Splitting“, und genau darum handelt es sich: um eine Spaltung. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, „Lehrerinnen und Lehrer“, „Regierungskritikerinnen und Regierungskritiker“ sind eben keine Paare, sondern per Sprechakt, entlang von Chromosomensatz und Hormonspiegel entzweite Gruppen.
Die Geschlechtertrennung existiert natürlich in der Realität, die Frage ist nur, ob man sie bei jeder Gelegenheit künstlich betonen muss. Ich persönlich bin gar nicht der Typ, der sich groß Gedanken um den „Zusammenhalt der Gesellschaft“ macht – die Gesellschaft (falls es so was gibt) war immer gespalten, vor allem in solche, die Interesse an Freiheit, Geist, Schönheit, Menschlichkeit haben, und solche, die den Menschen steuern, normieren, kleinhalten, beherrschen wollen, bzw. dergleichen mit sich machen lassen, um ihren kleinen Frieden und ihre Konsumenten-Ruhe nicht zu gefährden –, aber die sprachliche Spaltung ist pseudologisch, kleingeistig, kulturfeindlich, destruktiv, kurzum: falsch und fatal.
Es lässt sich beobachten, dass das Gendern mit Stern und Glottisschlag zwar nur vom harten Kern der Ideologen oder von den notorisch Beflissenen in Staatsmedien, Bildungseinrichtungen, Tugendindustrie und „Kultur“-Betrieb praktiziert wird, weite Teile der Bevölkerung wenden aber immer häufiger schon das „Splitting“ an, ältere Herrschaften etwa, die bei Kunst & Krempel von „Experten und Expertinnen“ ihre Familienschätze begutachten lassen, oder übergewichtige Arminia-Fans, die in der Lokalzeit Ostwestfalen über ihre abnehmwilligen „Kollegen und Kolleginnen“ sprechen. Sie tun dies vermutlich in dem Glauben, dass sie damit zumindest kompromissweise das Richtige tun, dass sie ihren guten Willen bezeugen und mit der Zeit gehen, ohne sich total verbiegen zu müssen. Es ist das altbekannt-typische Mitläuferverhalten: Ein bisschen mitmachen, was soll‘s, warum denn nicht? Man will‘s sich mit niemandem verscherzen, Widerstand ist zu anstrengend, was ist schon dabei, wenn man höflicherweise immer „Politikerinnen und Politiker“ sagt, „Journalistinnen und Journalisten“, „Wählerinnen und Wähler“? Nun, so einiges ist dabei …
Es gibt Unterarten des Deutschen. Man kennt in der Varietätenlinguistik verschiedene Funktiolekte, das sind Sprachstile, vom sozialen Kontext abhängige Mundarten sozusagen, die nach ihren jeweiligen kommunikativen Zwecken unterschieden werden können: Wissenschaftssprache, Behördensprache, Werbesprache, Literatursprache, Alltagssprache, etc. Die Gendersprache fügt den bisher bekannten Varietäten eine neue Kategorie hinzu: die Moralsprache. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sie auf der grammatischen Ebene bestimmte Signale ermöglicht, die den Sprecher als Angehörigen einer Wertegemeinschaft ausweisen. Oder zumindest als jemanden, der sich diesen Werten demonstrativ unterwirft.
Das Gendern begnügt sich – anders als die meisten sprachinvasiven Maßnahmen plumper totalitärer Regime – nicht mit der bloßen Neubenennung von Sachen, Personen, Institutionen oder der Neuschaffung von bekenntnishaften Grußformeln und dergleichen. Es setzt in der Tiefe der mentalen Ordnungen an, da, wo Klänge und Zeichen noch zu regelndes Rohmaterial sind, wo das Denken fast noch Lallen und Lautmalerei ist. Da, wo Weltanschauungen, Lebensgefühle vom flüssigen in den festen Aggregatzustand übergehen. Wo Stimmungen zu Gewohnheiten werden, wo die Muster des Normalitätsempfindens sich bilden. Sprachregelung ist immer Gedankenkanalisierung. Bewusstseinsorganisation und Charakterdesign. Herrschaft über das Gepräge.
Jene konzilianten Bürger, die sich leichtfertig der Doppelform bedienen, denken, Sie seien nur höflich, sie sind in Wahrheit aber unterwürfig, und sie lassen, indem sie das Haupt senken und Splitting-Formeln murmeln, eine Ideologie von ihrem Geist und ihrem Weltgefühl Besitz ergreifen, eine Ideologie der identitätspolitischen Sexualisierung.
Wie das? Nun, es ist eben ein Unterschied, ob man höflicherweise ein Publikum, welches aus weiblichen und männlichen Homines Sapientes besteht, mit „Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen“ begrüßt, um ihm dann in normalem Deutsch irgendetwas Interessantes zu erzählen, oder ob man in dem Vortrag, dem Radiointerview, der Bundestagsrede, in welcher Sprechsituation auch immer, zwanghaft und missionarisch von „Demokratinnen und Demokraten“, „Influencerinnen und Influencern“, „Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern“ redet, von „Parlamentarierinnen und Parlamentariern“, „Achtklässlerinnen und Achtklässlern“, „Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern“, „Volontärinnen und Volontären“, „Intendanten und Intendantinnen“, „Berichterstatterinnen und Berichterstattern“, „Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern“, „Gesetzgeberinnen und Gesetzgebern“, „Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern“, „Spekulantinnen und Spekulanten“, und gern auch mal von „Opferinnen und Opfern“ – nein, leider kein Witz, sondern O-Ton Sebastian Fiedler, SPD-Hauptkommissar, am 24.06.22 im Bundestag.
Der Unterschied besteht darin, dass die lieben „Kolleginnen und Kollegen“ in der Anrede einfach die Funktion eines Vokativs haben, das heißt, es spricht ein „Ich“ im Hier und Jetzt zu einem „Ihr“, einem präsenten oder imaginierten, jedenfalls aber konkret personalen und vermutlich (man kann den Leuten ja nicht in die Chromosomen gucken) beidgeschlechtlichen Kollektiv von Adressaten. Der Beziehungsaspekt kommunikativen Handelns gebietet in dieser Situation einen gewissen Grad der ausgesprochenen Kenntnisnahme oberflächlicher Identitätsmerkmale. (Wo andere Merkmale, Titel oder Ämter die Kenntnisnahme oder gar Ehrerbietung erfordern, werden auch diese ausgesprochen: „Liebe Kinder, allergnädigste Magnifizenzen, etc.“ Ist aber letztlich eine Frage von Konvention und Etikette, keine Frage der Grammatik. Man könnte schließlich auch sagen: „Liebes Publikum“ oder „Verehrte Anwesende“ oder „Yo, Leude“ oder „Herrschaften!“ oder „Deutsche!“)
Wer aber außerhalb des Höflichkeits-Vokativs permanent die Splittingform gebraucht, wer irgendwas über Gott und die Welt erzählt und dabei immerzu die Zweigeschlechtlichkeit dieser Welt herausstellt, der will nicht höflich sein, sondern erziehen, missionieren, belehren, penetrieren, Gehirne ficken. Er will in die Köpfe der Gegner eindringen und dort die gewohnten, gewachsenen neuronalen Netze umstrukturieren.
Im Ideologenjargon heißt es, man wolle „Frauen sichtbar machen“. Das macht man, in der Tat. Man macht Frauen sichtbar, und man macht Männer sichtbar, wo zuvor beide weitgehend unsichtbar waren. Warum? Warum etwas sichtbar machen, was in nahezu allen Zusammenhängen irrelevant ist? Weil es den aggressiven Wahnvorstellungen radikaler Feministen entspricht, dass das gemeine Volk weibliche Wesen für minderwertig hält und man daher den Leuten bei jeder Gelegenheit ins Gehirn schreien muss: dass Menschen mit Ovarien und Milchdrüsen genauso gut Panzer fahren können und genauso ewig Kanzlerämter einnehmen können wie Menschen mit Prostata und Halbglatze!
Ich habe übrigens nicht das Geringste dagegen, dass Frauen für Gleichberechtigung kämpfen, das sollen sie gerne und meinetwegen auch aggressiv tun, denn sonst wird ja wahrscheinlich niemals eine Frau Kanzlerin. Ich habe auch Verständnis dafür, dass wohl in jedem Kampf notwendigerweise Gewalt angewandt werden muss. Die wackeren Fighterinnen sollen gern gemeinsam mit Bürgermeistern und 3Sat-Moderatoren unterm Hermannsdenkmal ihre Latzhosen und ihre Highheels verbrennen und sich in spektakulären Krawall-Aktionen an Genderlehrstühlen festkleben. Sie sollen nur aufhören, meine geliebte deutsche Sprache zu verschandeln.
Und die große Mitläufermasse, die nicht kämpft, die auch gar nichts weiß von irgendeinem Kampf, sondern einfach nur mitläuft, mitlabert, mitsplittet, soll einfach mal aufhören, sich so schauderhaft gutwillig und unterwürfig zu gebärden.
[…]
Den vollständigen Essay finden Sie im Buch >> Stolpersterne
© Marcus J. Ludwig 2022
Alle Rechte vorbehalten