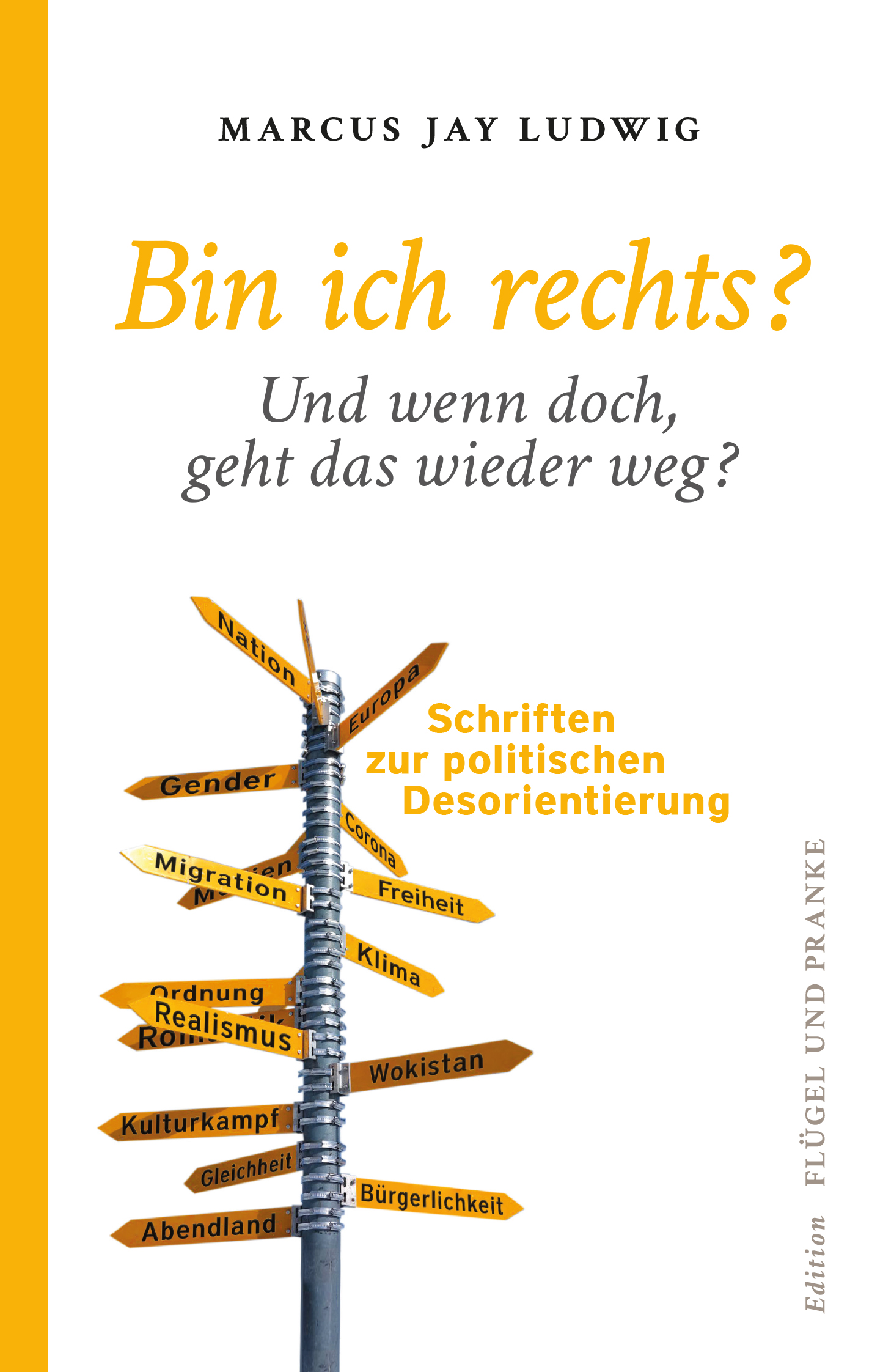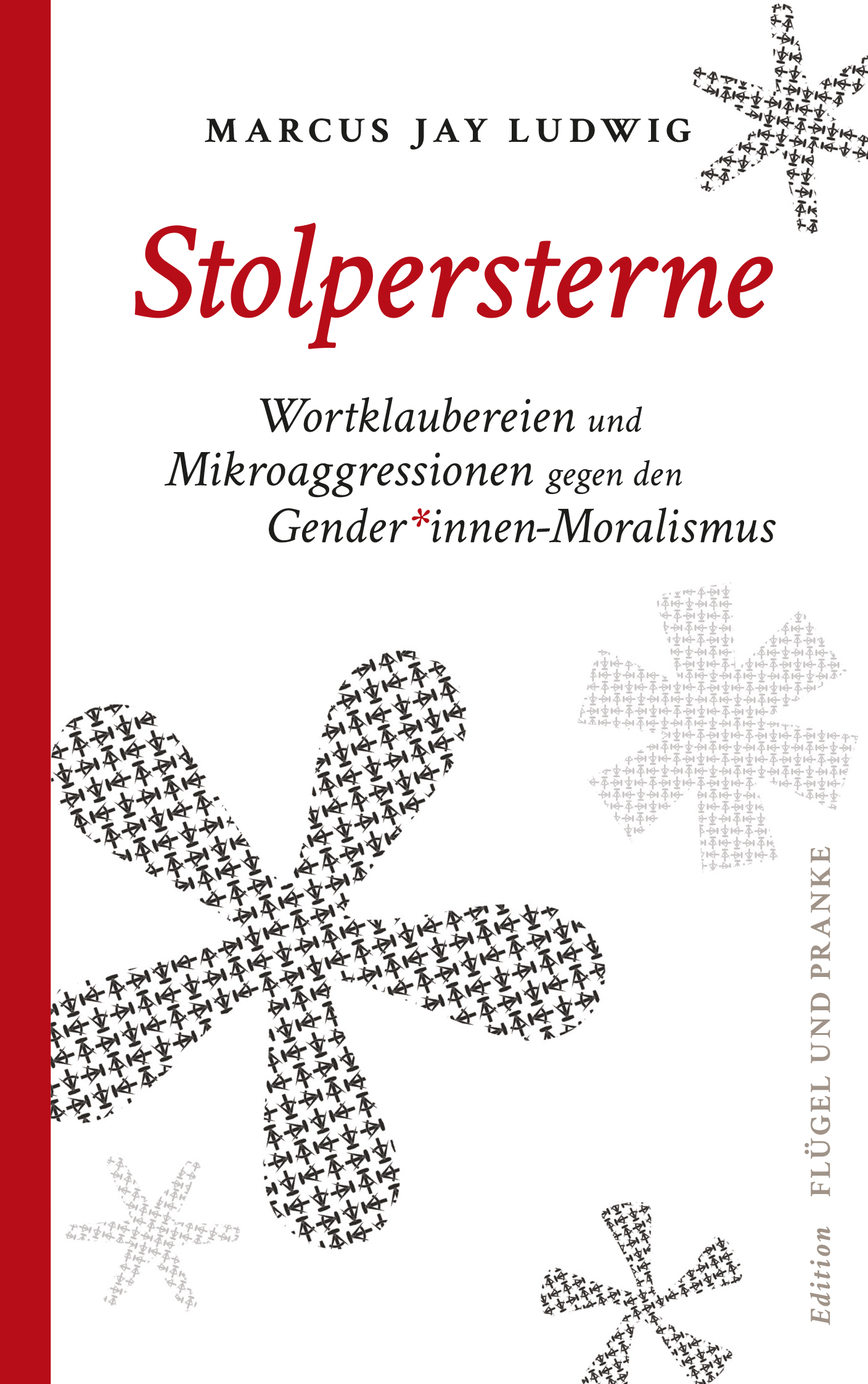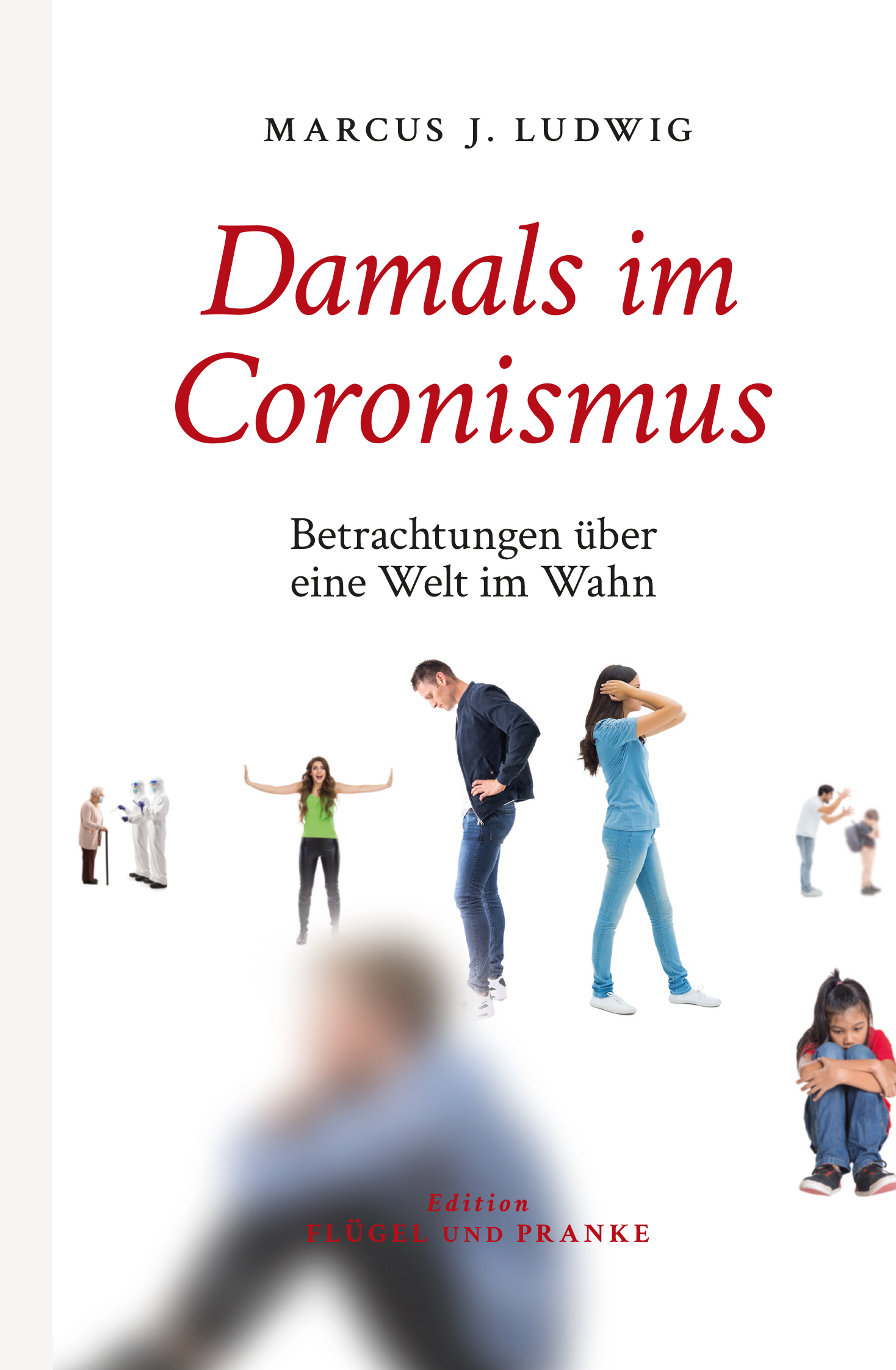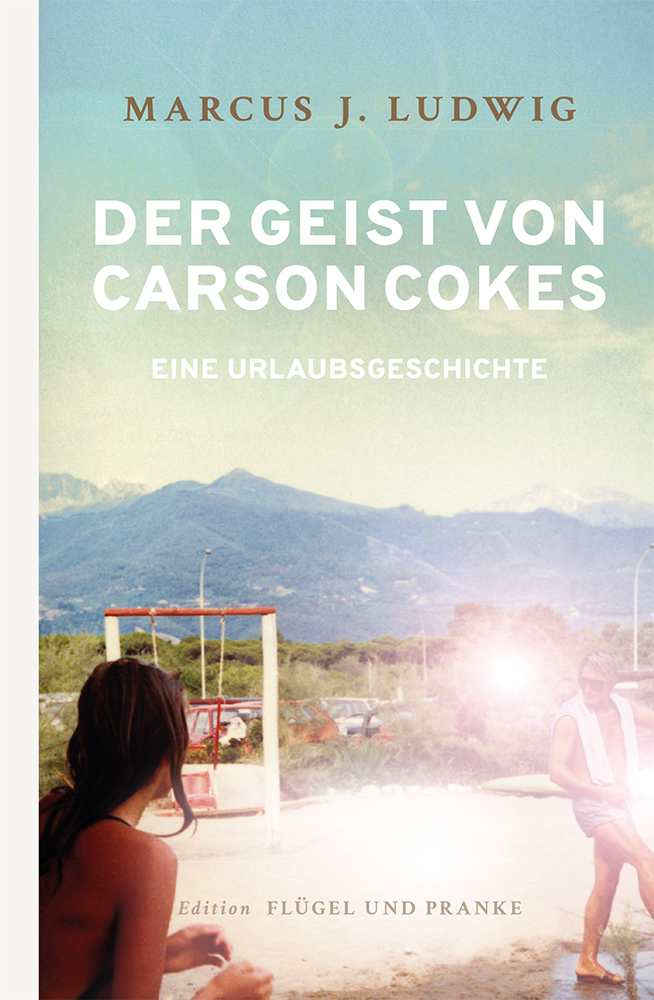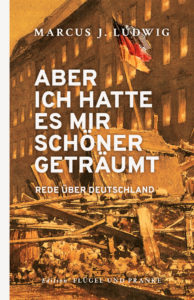Annäherungen an das politische Böse der Gegenwart
– – –
Was ist das, was wir gerade erleben? Wir, jene oppositionellen Realisten, die zur Flucht aus der Zeit irgendwie doch immer noch zu fasziniert von ihr sind, die zum billigen Ablenkungskonsum zu asketisch und zu anspruchsvoll, zum trostreichen Drogen-Eskapismus nicht rücksichtslos oder nicht reich genug sind, wir, die zum verlogenen Übersehen des Faktischen oder des immerhin Fragwürdigen um irgendeines lieben Friedens willen einfach zu tatsachensüchtig sind – wir merken, wie die Geschichte auf Abwege gerät, wir spüren – gelegentlichen Machtwechseln und Umbesetzungen innerhalb der politischen Klasse zum Trotz – die zunehmende Schräglage der Welt. Die Welt, mindestens die westliche Welt und in ihr besonders die deutsche Welt, ist offenkundig in eine Phase eingetreten, die die Historiker irgendwann einmal werden benennen müssen, als das Zeitalter des XY oder die XY-Jahre.
Was aber ist dieses XY, was prägt die politische Physiognomie der Epoche? Welche Fratze lächelt uns da kalt und falsch entgegen, wenn wir im Dunkeln zur Decke starren und uns fragen, ob wir je wieder unsern Frieden machen können mit der Zeit, wie sie nun mal geworden und womöglich nicht mehr zu ändern ist.
Die zackig geflügelten Worte, die hier und da durch die alternative Öffentlichkeit schwirren, sie wollen uns aufschrecken aus der Erschöpfung, uns empören gegen das fatale Hinüberschlafen in eine neue Normalität, gewiss zu Recht, aber … treffen sie die Sache? Corona-Faschismus, Klima-Diktatur, Totalitarismus, Orwell, Unrechtsregime, Impf-Apartheid, Autoritarismus, Despotie, Tyrannei, vor allem aber, und immer wieder: Faschismus. Man operiert mit Termini, die einem aus den geschichtlich bekannten Entartungen des Politischen geläufig sind. Aber, im Ernst: Wir haben uns unter Faschismus immer etwas sehr anderes vorgestellt als das, was momentan stattfindet, oder? Was die Geschichtsbücher und die History-Dokus unter dieser Rubrik präsentieren, sind Führerstaaten, verzückte Massen, uniformierte Männerbünde, Squadre d’azione, Parteiarmeen, kultisch durchdesignte Versammlungs- und Aufmarschstätten, Ordnungs- und Reinigungsphantasmagorien, Auslöschungsprojekte. Wir mögen geistige Anklänge finden, die uns alarmieren müssen, die uns im Heutigen sorgenvoll erinnern müssen an die kollektiven Delirien aus schwarz-weißen Zeiten, aber es scheint mir wenig nutzbringend, wenig erkenntnisförderlich, unserer Gegenwart einen hundert Jahre alten Gift-Stempel aufzudrücken, ein Reizwort, das uns verleitet, heutige Machthaber und Diskursherrscher als theatralisch herumgeifernde Schwarz- und Braunhemden zu imaginieren. Nein, wir brauchen andere Worte für das Andere, das Neue, das gerade geschieht.
Ich selber habe diverse Vokabeln verwendet, die mir im Rückblick mal mehr, mal weniger durchdacht und treffend erscheinen. Ich bin Musiker, ich bin leicht verführbar durch den Klang, den Rhythmus und die Assoziationspracht eines Wortes. Coronismus, Hygienediktatur, Sanitätsstaat, Schwarmdebilität, RKIsmus, Szientokratie – ich weiß gar nicht mehr, welche dieser Worte ich mir selbst ausgedacht habe. Sie passen irgendwie in ihrem jeweiligen Kontext, aber wenn es darum geht, einmal ganz unmusikalisch und nüchtern an die Sache heranzutreten, dann muss die Vorgabe sein, den maximal präzisen Terminus zu finden, der so unpoetisch und so assoziationsarm wie nur möglich ist. Es scheint mir nicht nur eine Frage des semantischen Ehrgeizes, vielmehr ein zeitdiagnostisches Desiderat ersten Ranges zu sein, die Gegenwart irgendwie auf den Begriff zu bringen. Das Übel muss exakt benannt und erkannt sein, damit die oppositionellen Kräfte sich fokussiert dagegen formieren können.
„Faschismus“ ist ein schmissiges Schimpfwort, es macht richtig Laune, es dem Gegner mit Beckengeschmetter auf der zweiten Silbe entgegenzuschleudern [1], aber wenig ist gewonnen, wenn man den Begriff ernsthaft auf alles ausdehnt, was irgendwie totalitär, übergriffig, autoritär, freiheitsfeindlich, menschenverachtend anmutet. Willkürherrschaft, Einschüchterung und Ausgrenzung von Andersdenkenden, Gleichschaltungsprozesse, Gruppenmoralismus etc. sind keine exklusiv faschistischen Erscheinungsformen politischer Karzinose.
[…]
Den vollständigen Text finden Sie im Buch >> Bin ich rechts? – Und wenn doch, geht das wieder weg?
[1] Dass eine unbedarfte Floristin zum Volkstrauertag 2019 auf einen SPD-Kranz für die Opfer von Krieg und Faschismus aus Versehen – besser gesagt: aus Verhören – Verschissmus drucken ließ, entbehrt nicht einer gewissen psycholinguistischen Logik. Angesichts der landläufigen Sprachpraxis muss man Faschismus tatsächlich eher zum Vokabular der Fäkalsprache rechnen als zum historisch-politischen Wortschatz.
© Marcus J. Ludwig 2021.
Alle Rechte vorbehalten.