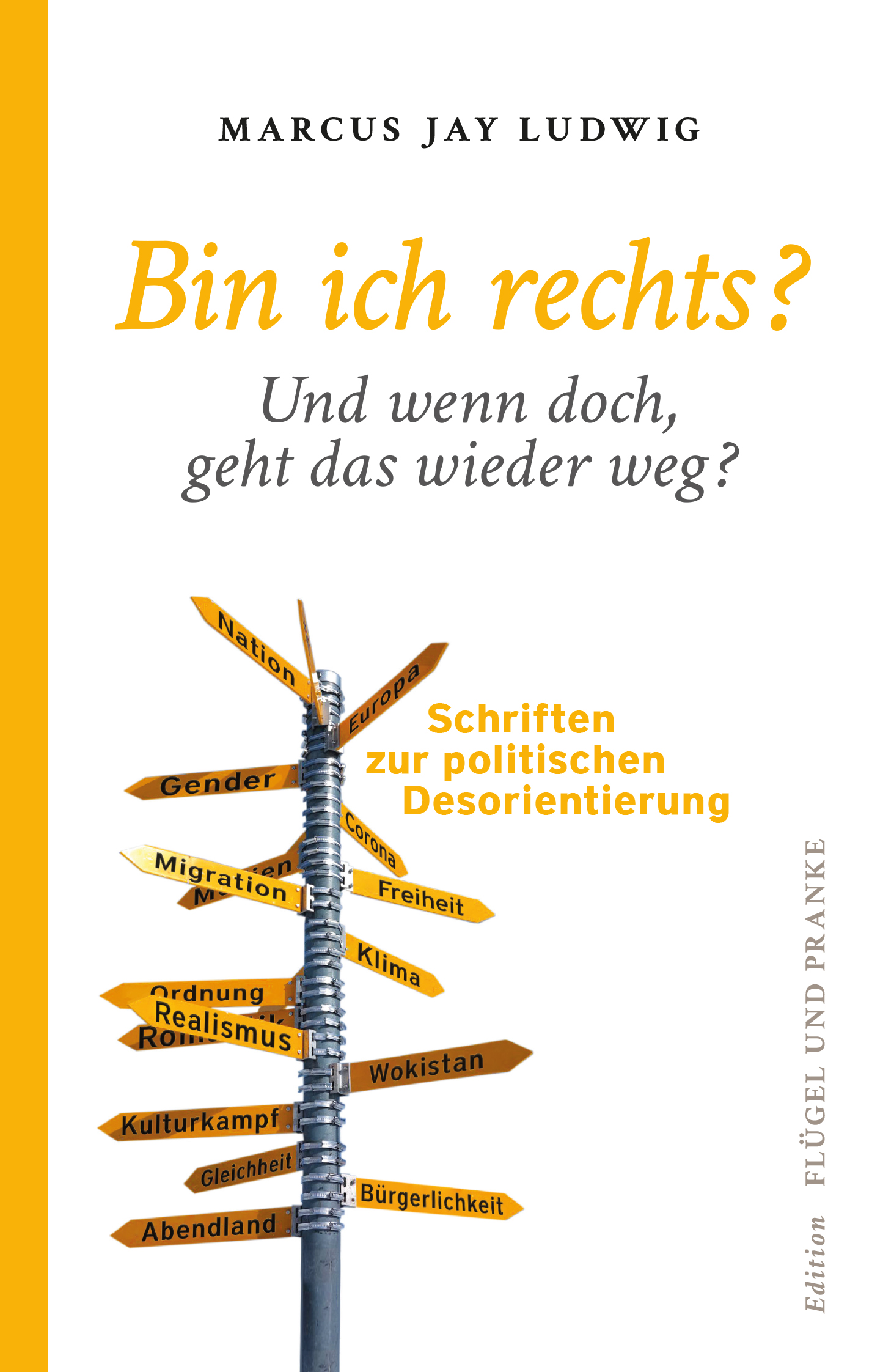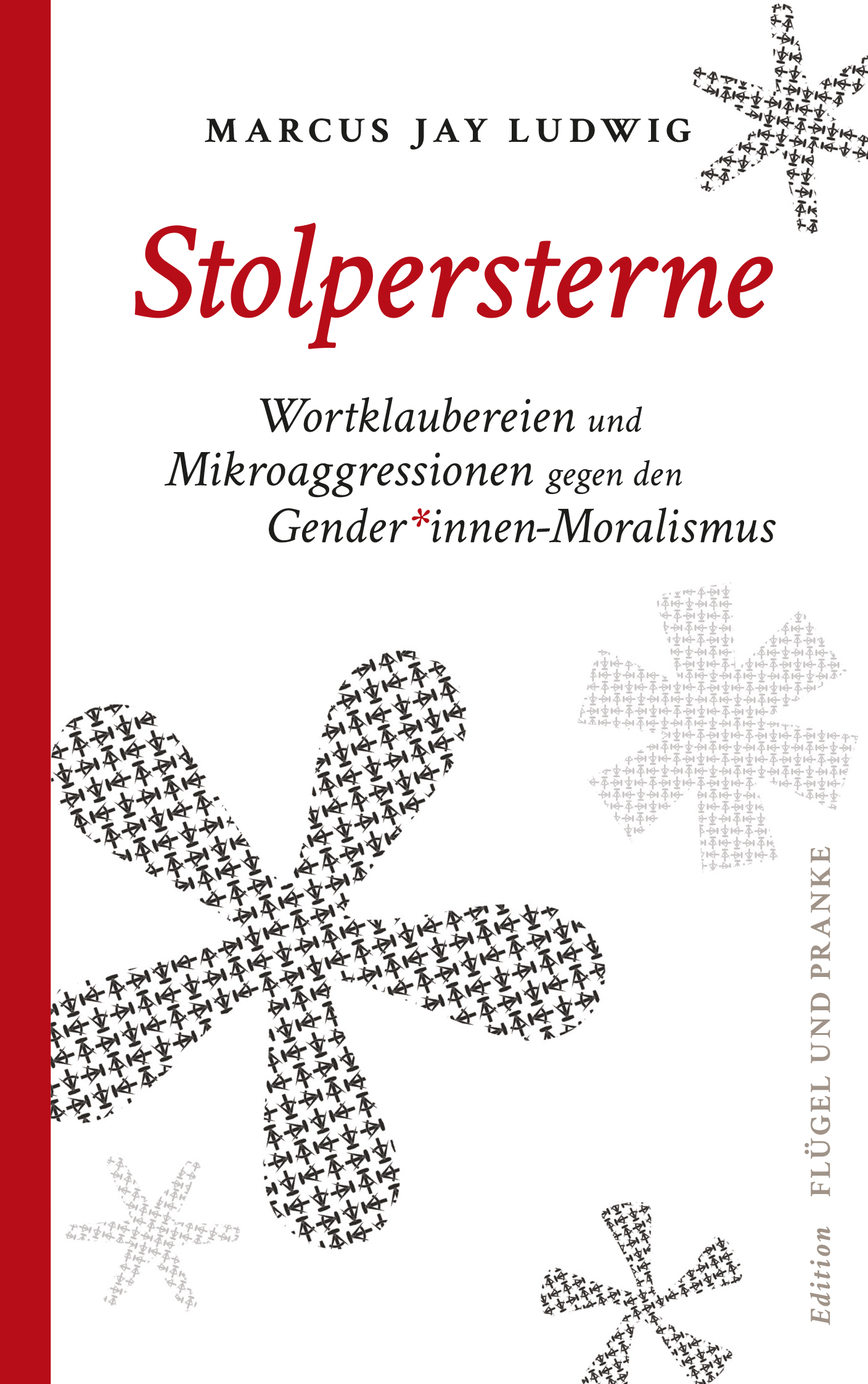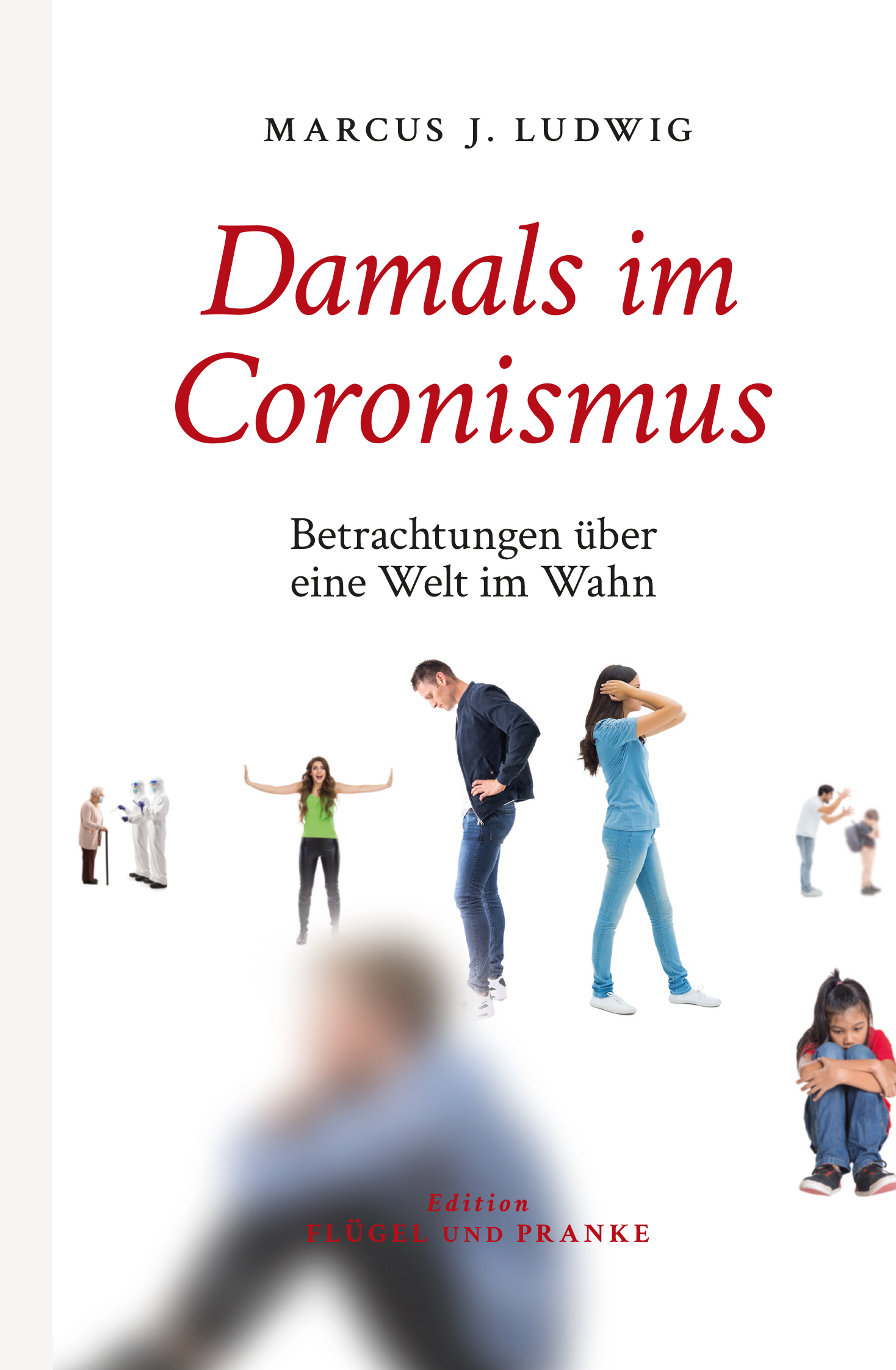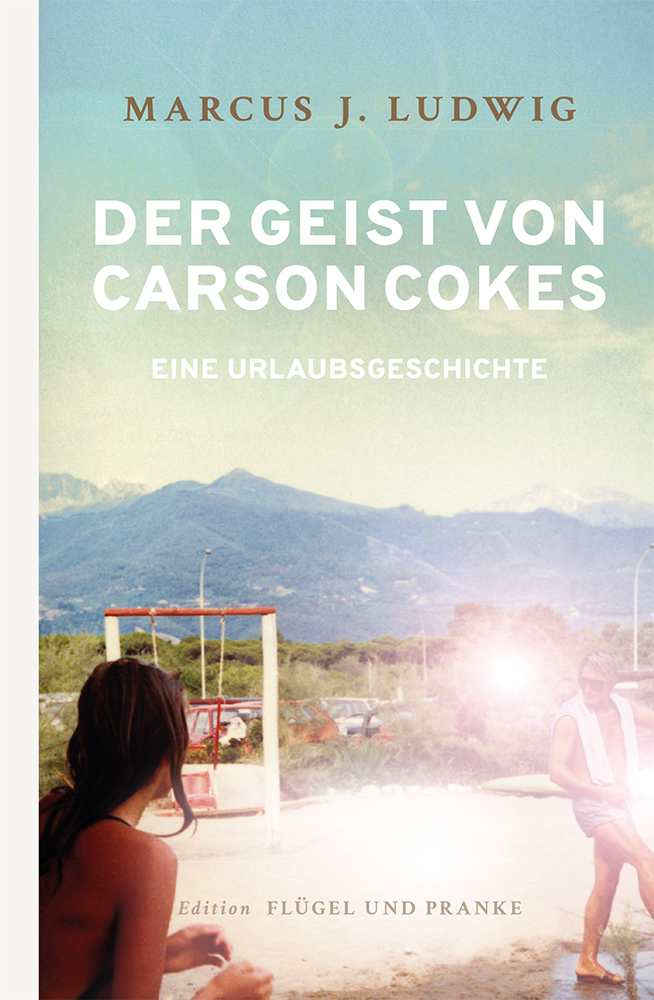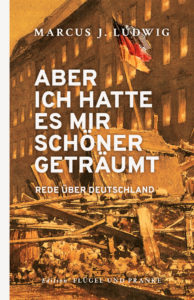Deutschland lechzt nach meiner Wahlempfehlung. Das Volk stolpert unentschlossen und desorientiert durch Wälder von Wahlplakaten, es zockt sich am Wahlomat die Finger blutig, doch der spuckt immer nur uninterpretierbare Vieldeutigkeiten aus: Humanisten, V-Partei, NPD, Linke, Tierschutzpartei, Team Todenhöfer, Graue Murmeltiere liegen alle bei etwa 50 Prozent Übereinstimmung, knapp dahinter oder davor Grüne, AfD, Die PARTEI, ÖDP, und egal, wie man Antworten gewichtet und welche Beschwörungsformeln man flüstert, es kommt immer irgendwas in dieser Art heraus. Erfrischend klar ist immerhin der ewig letzte Platz für die FDP mit etwa 35 Prozent. Aber ein eindeutiger erster Platz mit 95 Prozent, wo dann zu Tusch und Bildschirm-Feuerwerk eine Lottofeenstimme sagt: „Herzlichen Glückwunsch, deine Partei ist die XYP, die musst du wählen!“, kommt einfach nicht zustande. Was soll das Volk also machen?
Okay, ich seh’s ein. Wie immer, wenn der Wahlomat versagt, muss ich es denn wohl richten. Ich hab zwar keine milliardenschwere Bundeszentrale für politische Bildung im Rücken, die mir für den Job die gebührende Aufwandsentschädigung transferieren würde, aber arbeite ich in diesem Business denn für die schnelle Mark?[1] Für den Kick, für den Augenblick? Nein, meine Schäfchen und Spätzchen, ich tu‘s aus reiner Bonhomie, aus Barmherzigkeit und Bürgerstolz, ich tu‘s als Beau Geste, für lau, nur für die Leuchtkraft des Lichtleibs, der mir auf Markt und Gasse das ehrfurchtsvolle Tuscheln des Volkes einträgt, den warmen Händedruck des einfachen Mannes, den artigen Knicks der Jungfer und dann und wann ein dankbares, zukunftsfrohes Kinderlächeln.
Wohlan, meine stimmviehischen Brüder und Schwestern, höret denn meine Wahlempfehlung: Wählet am 26. September 2021 die … Sekunde, Sekunde! Ich glaube, ich sollte, bevor ich jetzt schon irgendein Parteienakronym nenne, eine klitzekleine Erörterung voranschicken, denn wenn hier erst einmal SSW oder CSU oder DKP, SGP, LKR, DIB oder PDF oder was auch immer steht, dann liest ja keiner mehr weiter, und dann bin ich für alle Zeiten nur noch der, der diese oder jene drei Buchstaben empfohlen hat.
Ich würde also voranschicken wollen, dass man als gutwilliger Zeitgenosse, der brav seine monatlichen Spenden für arme Tiere und notleidende Menschen entrichtet und sich regelmäßig an Heine-Lyrik über das frühsozialistisch zu erkämpfende Erdenglück berauscht, eigentlich wohl irgendwas Linkes wählen müsste. Sogar Thomas Mann, dessen Autorität ich bislang nie Grund hatte anzuzweifeln (auch wenn er weder Veganer war, noch auf Vokabeln wie „Nigger“ verzichten konnte), rang sich bekanntlich einmal zu der Feststellung durch, dass „der Platz des deutschen Bürgertums heute an der Seite der Sozialdemokratie sei.“[2] Dieses „Heute“ war allerdings 1930, und in unserem Heute sind längst alle Parteien, die auf dem Wahlzettel stehen, Parteien des demokratischen Sozialismus, ausnahmslos. Unser Wohlfahrtsstaat, unser Bildungssystem, unsere Klassenlosigkeit, unsere Arbeitszeitstandards toppen alles, was Heine, Freiligrath, Herwegh und spätere Ausbeutungsanprangerer und Arbeiterrechteerstreiter sich zu erträumen gewagt hätten. Und keine Partei, soweit mir bekannt ist, will diese Errungenschaften sozialistischer, sozialdemokratischer Jahrhundertarbeit rückgängig machen.
Wenn also eh alle in diesem Sinne links sind, muss man dann noch die wählen, die sich explizit so nennen?
[…]
Den vollständigen Text finden Sie im Buch >> Bin ich rechts? – Und wenn doch, geht das wieder weg?
[1] Aus welchem Film stammt dieses Zitat? Wer’s weiß, wird Kulturminister im ersten Kabinett Ludwig.
[2] Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft. Vortrag am 17.10.1930 in Berlin.
© Marcus J. Ludwig 2021.
Alle Rechte vorbehalten.