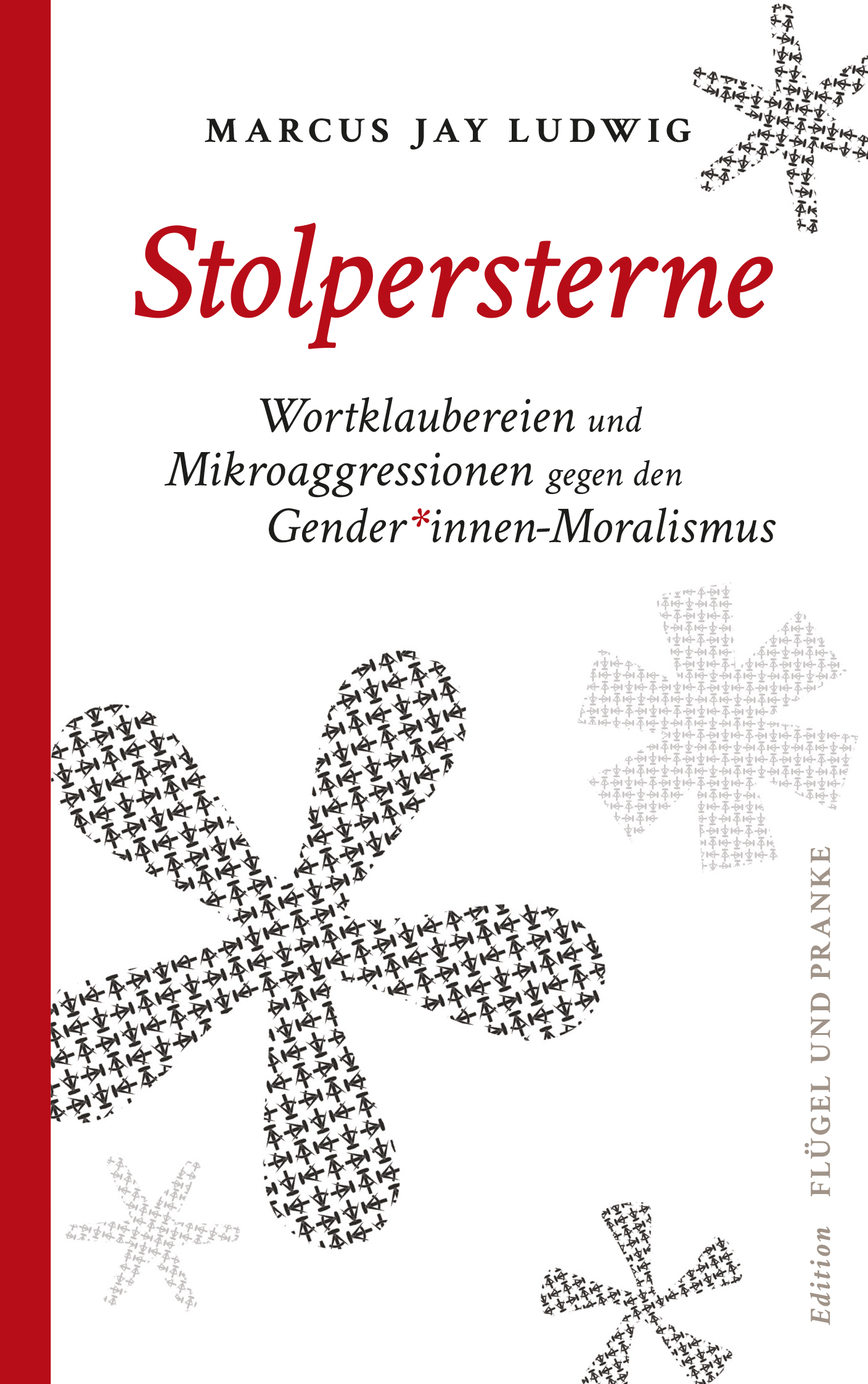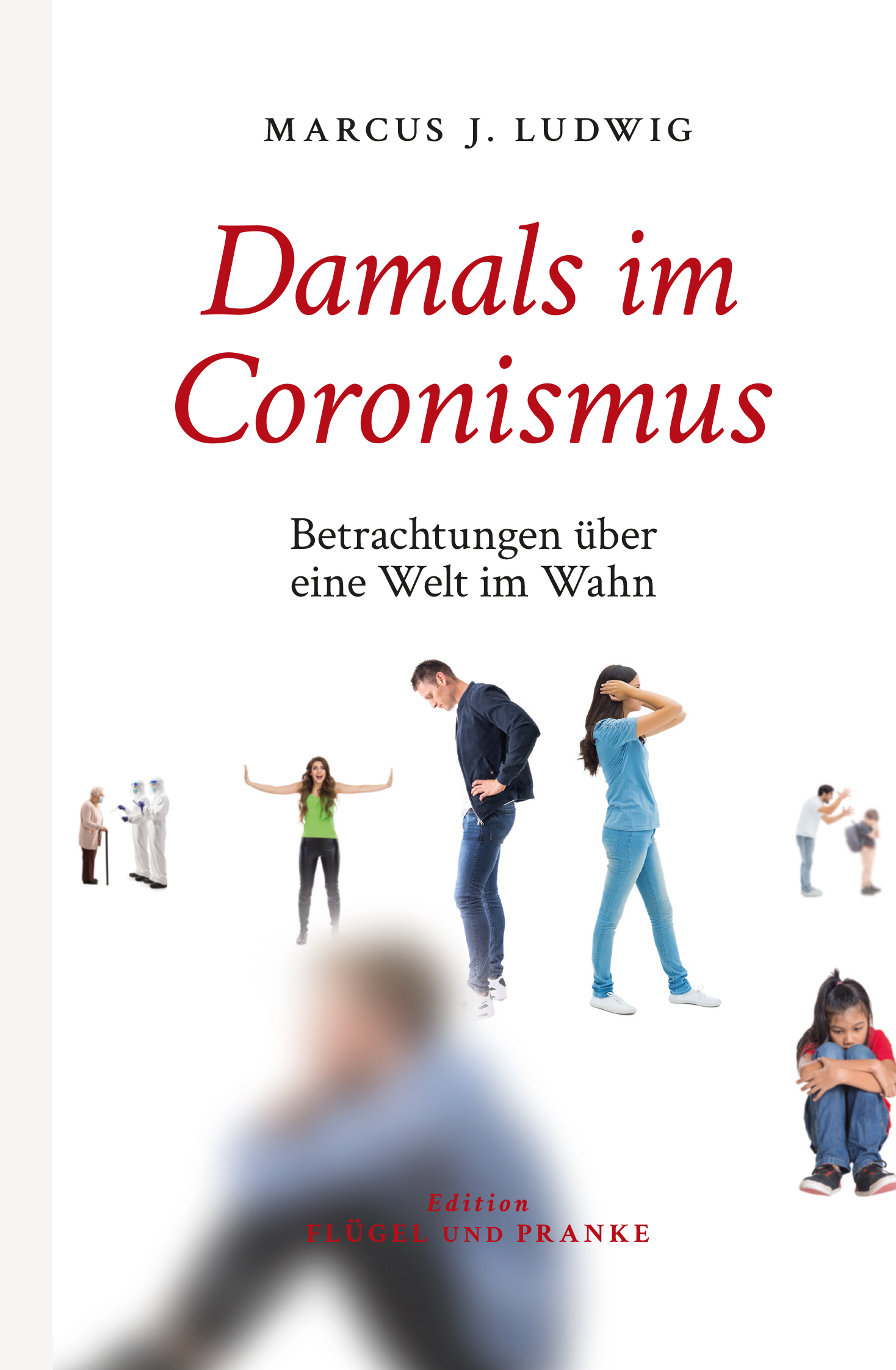Meditation über Mel Gibsons Christus
Der nackte, aufgespannte Körper, aller Schutzhaltung beraubt, freigegeben zu jeder Berührung, jedem Blick, jeder Aktion, von Kitzelei bis Kastration. Der Feind arretiert das Gebein, Eisen durch Knochen und Holz, Härte ganz außen, Bloßlegung der Weichteile. Maximale Exposition und finale Hemmung basalster Instinkte. Foltertheater, gleißende Bühne bis in den Tod.
Im Leben fällt der bedrohte Körper reflexhaft in die Embryonalstellung, das Menschentier schützt den neuralgischen Bauch, es windet sich, wird wieder Würmchen, widerwillig geborenes Muttersöhnchen, rollt sich zusammen gegen den Zwang zur Entfaltung. Das Menschlein zieht den Kopf ein, die Schultern hoch, es krümmt den Rücken, macht sich so klein und kugelig wie es nur kann, reduziert die Angriffsfläche, wendet alle wehrhaften Gliedmaßen, alle biologischen Planken und Schilde gegen die Schläge der Schergen. Der Organismus im Notprogramm, der Leib, der überleben will, schirmt Eingeweide und Zeugung, Innereien und Aidoia, empfindlichste Extremitäten zur Welt.
Und jetzt: Kein Verkriechen, kein Entfliehen und Ducken und Einigeln, kein Kleinmachen. Die Darbietung der Körperfront gegen alle Impulse der Todesangst – es gibt nichts Bedrohlicheres für ein ungepanzertes Wirbeltier, sei es Ochsenfrosch oder Gottessohn. Die Kreatur am Kreuz hat nichts mehr entgegenzusetzen, sie kann sich nicht krümmen, kann nicht einmal einen Juckreiz an der Nase verjagen. Lächerlich und erbarmungswürdig, entehrt und zerstört, erniedrigt und blutig erhöht zu öffentlichstem Verrecken. Klaffendes, keuchendes Fleisch, unfähig sich selbst zu beenden.
Kann ein Mensch dergleichen freiwillig auf sich nehmen?
* * *
Auf dem Weg nach Golgatha, der aufgerissene, niedergebrochene Mann aus Nazareth, ein Satz sammelt sich wie Blut in seinem Mund, ein Satz, den das Evangelium nicht kennt. Er stammt aus der Offenbarung … aber will man nicht sofort glauben, dass der Menschensohn und Schmerzensmann ihn gesagt haben muss, zahnlos und triefend, in zersplittertem Aramäisch, genau da und dort, wo der Geist der Erzählung ihm das wahnhaft-wegweisende Wort erteilt?
Vera Ikon, Salvator Mundi … Mutter, was suchst du nach Antworten in seinem rotüberströmten Gesicht … hast du diesen Jungen geboren und aufgezogen, dass er nun endet als Aas und in Fetzen ans Kreuz geheftet wird? Geschunden, zertrümmert, verlacht und verspottet … was soll dieses freiwillige Leiden … und suchte der Junge nicht gerade danach, nach diesem königlichen Martyrium …
Und die Antwort, die du bekommst, während er sich aufrichtet, aufquält, um allen weiteren Qualen entgegenzutaumeln, ist der abwegigste und glaubensbesoffenste, der lächerlichste und revolutionärste Satz, den die Welt je gehört hat: Siehe Mutter, ich mache alles neu!
Ja, jetzt ist er endgültig wahnsinnig geworden … wie sollte er nicht, wo alles an ihm, außer dem bisschen verkapselten Geist, dem er zur Not noch befiehlt, in Flammen steht. Flächenbrand, lodernder Aderlass, feuernde Nozizeptoren, alles, was Nervenenden nicht mehr verschmerzen, nichts, was noch irgendeinen Umsturz verhindert: Nein nein – ich mache nicht dies und das neu – sieh mich an! Sieh mich an: Ich mache alles neu!
Wie um alles in dieser gottverdammten Welt gedenkt dieser halbtote, schon vor der Schädelstätte ausblutende Staatsfeind irgendetwas neu zu machen … gegen alle Offensichtlichkeit den Glauben behalten, dass die Tat und das Opfer gesehen werden und weitererzählt werden und eine Erzählung begründen werden, die die Welt verändern muss. Jesus, Künstler und Revolutionär, Jesus, posthumer Dichter und Täter seines Lebens.
Gibson beweist Gespür für Größe und überwältigendes Pathos, wenn er seinem Christus diesen Satz in den Mund legt, wenn er abweicht von seinen Vorlagen, von Brentanos Bitteren Leiden, den niederdeutschen Gesichten der stigmatisierten Bauerstochter Anna Katharina Emmerick, vom Johannes-Evangelisten. Er schafft damit den eigentlichen Höhepunkt des Films, feiert jene frohe Botschaft, die man dem Werk von kleinkariert-theologischer Seite immer abgesprochen hat. Als wäre alles nur Schlachtfest und Passionsporno, kathartischer Terror und kindischer Wörtlichkeitsverismus. Nein, hier zeigt sich der Filmemacher als Evangelist, der begriffen hat, wozu all das Blut, all das sinnlose somatische Schinden, das Zerbrechen und Zerpeitschen notwendig war, warum es sogar schön war auf eine schauerliche Art, die über das Erbarmen und die Ehrfurcht sich zur Bejahung des Äußersten durchringt. Triumph und Selbstermächtigung und Umwertung der Welt.
Siehe, ich mache alles neu. – Es ist aber auch und vor allem psychologisch ungeheuer wahr: dass er es zu seiner Mutter sagt. Er könnte es ja auch zu jedem andern am Wegesrand sagen. Aber zur Mutter muss er es sagen. Er ist nicht mehr der Junge, der hinfällt und von der immerdar Sorgenden aufgehoben und getröstet wird. Er bedarf des Trostes nicht länger, er geht den letzten Weg zur Erwachsenheit, zur ganzen Menschwerdung: alleine. Nach allen denkbaren Prüfungen und Peinigungen. Er lässt die Mutter am Wegesrand zurück, er muss sie zurücklassen. „Alles neu machen“, das heißt eben auch: die Mutter zurücklassen, sich selbst als Kind und Gewordenen zurücklassen, den irdischen Leib zurücklassen, den schmerzenden Kinderkörper, das ganze trostbedürftige Kind zurücklassen. Vergessen, dass man jemals Kind sein musste. Den Zufall dementieren, der einen aus diesem oder jenem Säugetierschoß hat kriechen lassen. Die Beliebigkeit überwinden. Das Leben in die eigene Hand nehmen und wegwerfen oder in ein Glaubenswunder verwandeln, wenn einem danach ist. Am Kreuz hängen, bis man alles für immer vergessen hat oder zu einer weltgeschichtlichen Unübersehbarkeit geworden ist. Das Neue erzwingen, die Welt foltern durch den eigenen Schmerz. Bis das erlösende Gewitter niederprasselt.
* * *
„Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von obenherab gegeben“, spricht Jesus zu Pilatus. Schwächelnder Statthalter, skeptischer Saubermann, der nie wissen wird, dass er nur Werkzeug war in den Händen dessen, den er dem geifernden Gesindel ausliefern wird. Unschuldige Notwendigkeit im Kranze der Arma Christi.
„Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich loszugeben?“ Macht von obenherab … Menschen haben Macht über Menschen, solange sie Angst vor Schmerz, Leid, Demütigung haben. Wer aber glaubt, dass dies alles nicht zählt, nur vorläufiger Schein und Geburtswehe zum eigentlichen Leben sei, der ist unbeherrschbar. In der Welt habt ihr Angst, aber Jesu Lehre ist keine Politik für diese Welt. Es gibt diese Welt ja gar nicht, und die Schmerzen gibt es auch nur für den, der an sie glaubt. Das zumindest müsste man glauben als Christ, das müsste man sich suggerieren, um sich ernstnehmen zu können als Träger des eigenen Kreuzes, als Nachfolger Christi. Und es wäre vollbracht. Man kann Christ nur sein als Fundamentalist … kein Bürger, kein Mensch von dieser Welt, von diesem Staat, diesem Menschen- und Sozialgewese hat je das Reich Gottes von innen gesehen. Christ oder Bürger, man muss sich entscheiden.
Die Welt überwinden, die Schmerzen negieren, ins Himmlische sich hineinsteigern … ich könnte das wohl, wenn ich nur ein wenig weniger wüsste über das Wesen der Wünsche. Die Herkunft der Gottessehnsucht, die Zukunft einer Illusion. Ich weiß, es ist armselig und kleinmütig, ein spießiger Skeptizismus geradezu, dem bürgerlichen Juden aus der Berggasse 19 mehr zu glauben als dem Erlöser aus der Via Dolorosa. Aber ich war nicht Herr über die Gewundenheiten des Lebens, meine Wege gingen notwendig in die Irre. Vielleicht habe ich zu früh zu schwer getragen an meinem kleinen Kinderkreuz, um mich jetzt noch mal ernsthaft um Himmel oder Hölle zu bewerben. Irgendwas wird passieren, höchstwahrscheinlich nichts. Nichts außer Schmerzen. Sinnloses, hyperreales Leiden … zweitausend Jahren Glockengeläuts und Karfreitagszaubers zum Trotz. Alles wird vergeblich gewesen sein. Ich würde mich gewiss gern erlösen lassen, aber ich fürchte, ich werd nur verwesen.
Du hast keine Macht über mich, Herr. Leider. Ich wünschte, du hättest sie. Glaub mir, das ist die Wahrheit. Ich wünschte, ich müsste ein Christ sein. Gläubig, beseelt, zum Gehorsam begabt von obenherab. Doch von irgendwoher kam mir die Freiheit dazwischen. Woher? Vielleicht von untenherauf?
* * *
So glaubhaft und wohlgefällig Gibsons Christus dargestellt ist, so seltsam abwegig scheint der Satan in Szene gesetzt. Wer mit dem klassischen Teufel, dem feuerrot Gehörnten aufgewachsen ist, der kann sich nur schwer anfreunden mit diesem androgynen Grottenolm, diesem blau und blässlich lauernden Mischwesen, das doch etwas zu kalt und verhalten angelegt ist, um einem so richtig Angst einzujagen.
Mein Jesus war, wenn ich’s recht bedenke, eigentlich immer ein Film-Jesus. Ich habe zwar von klein auf die Bibel gelesen – zunächst lesen müssen, später dann auch freiwillig studiert im pubertären Aufbäumen gegen den Abfall vom Glauben. Aber das Gegenüber meiner Gebete war nie eine Emanation der Schrift – da steht ja schließlich auch nirgendwo, wie dieser messianische Zimmermann ausgesehen hat –, sondern einfach das sanftmütige Leidensgesicht Robert Powells (Jesus von Nazareth, 1977), Jeffrey Hunters (König der Könige, 1961) oder Max von Sydows (Die größte Geschichte aller Zeiten, 1965), beziehungsweise jene ideale Mischung, die die Fantasie eines sechsjährigen, achtjährigen Kindes daraus zu bilden imstande ist.
Kein Christus meiner Kindheit aber sah so ideal aus wie Jim Caviezel. Hätte Gibson das ganze Leben Jesu Christi mit diesem JC verfilmt statt nur das blutige Ende, hätte er einen vierzigstündigen Zwanzigteiler vorgelegt mit dieser ikonischen Inkarnation des Heilands, ich hätte vielleicht zum Glauben, zur Kirche, meinetwegen zu irgendeiner Sekte zurückfinden können.
Nein, die Schrift allein reicht mir nicht, das Wort kann nie so sehr überzeugen, überreden, überwältigen wie ein Antlitz in Bewegung und eine Stimme, die aus einem echten Menschenkörper, aus echtem Fleisch und Blut herauftönt in die Welt. Eine Religion ohne Bilder, ein Glaube ohne Gesicht, eine Lehre ohne Laut und Farbe mag Protestanten, Buchhaltern und sonstigen Geistwesen genügen – für Katholikenkinder, die unter Musikern und scheinheiligen Sauerländern aufgewachsen sind, reicht es nicht. Ja, es steht geschrieben: „Du solt dir kein Bildnis noch jrgend ein Gleichnis machen / weder des das oben im Himel / noch des das vnten auff Erden / oder des das im Wasser vnter der erden ist.“ Aber was steht nicht alles geschrieben … hätte Moses Mel Gibsons filmisches Jesusbildnis gesehen, hätte er das mit dem Bilderverbot sicherlich nochmal überdacht oder einfach präziser formuliert, denn gemeint ist ja vor allem die Anbetung von Götzenbildern und Statuen. Du sollst dich nicht vor geschnitzten Idolen und Fetischen niederwerfen! Aber das, was wir tun, wenn wir dem per Schauspielkunst verkörperten Galiläer auf seinem Schmerzensweg folgen, ist ja kein Zaubertanz um ein goldenes Kalb, sondern Imitatio Passionis, Mitleid und Mimesis. Fragwürdig gewiss, solch existenzielle Einfühlung vom Fernsehsessel aus, aber immerhin.
Schock und Andacht, Horror und Zentrierung, verschwimmende Scharfblicke, erschütterte Gewissheiten und schlaflose Nachtstunden. Welche Karfreitagsmesse, welches Pastorengeseier, welches abgesoftete Dekokreuz, welche rundgelutschten Abstrakta unserer Gegenwartskirchen könnten auch nur ansatzweise mithalten, wenn es um Glaubensglut und Begeisterung geht, wenn es darum geht, in den Abtrünnigen und Erloschenen doch noch einmal etwas anzufachen, was entfernt einem Flämmchen ähnelt. Der Evangelist Gibson facht etwas an in mir. Zumindest für die Dauer eines Films oder eines unbeholfenen, als Essay getarnten Gebets. Und ich bin nicht einmal sicher, ob ich das will.
Sicher aber ist: wenn das Christentum eine Zukunft haben soll, wird es mehr verrückte australische Filmemacher brauchen und weniger deutsches Episkopal- und Synodalgeschwätz.
* * *
Ganz sicher ist ferner, dass das Christentum eine Vergangenheit hat, und dass diese zurückliegenden zweitausend Jahre wohl das Allerseltsamste sind, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Hätten hyperintelligente, hyperrationale Außerirdische, sagen wir: ein vulkanisches Geschichtsprognostiker-Team, am Tage vor Jesu Gefangennahme in Gethsemane die Weltlage analysiert und Vorhersagen über die weitere Entwicklung der Menschheit getroffen, sie wären in ihren kühnsten Kalkulationen und Fantasien nicht auf die Idee gekommen, dass die Hinrichtung eines verschrobenen Wanderpredigers das Ereignis sein könnte, das mehr als alles andere den Lauf der Dinge bestimmen würde.
Alles wäre ja anders gekommen, wenn man Jesus nur ausgelacht und mitsamt seiner verlausten Anhängerschaft aus Jerusalem hinausgetrieben hätte. Nichts von dem, was unser heutiges Leben ausmacht, gäbe es ohne das Christentum, ohne die christliche Kultur, ohne die Herrschaft der Kirche, ohne den Kampf gegen das christliche Denken, ohne die Überwindung der abendländisch-kirchlichen Mentalität. Keine zivilisierte Welt ohne Europa, kein Europa ohne Christentum, kein Christentum ohne Christus.
Man mache sich kurz einmal klar, was von den zurückliegenden zweitausend Jahren zu halten ist, wenn Jesus von Nazareth nicht der Sohn Gottes gewesen sein sollte. Wenn alles, was heute so ist, wie es nun mal geworden ist, auf einem frommen Phantasma beruht. Und eben das dürfte ja wohl höchstwahrscheinlich der Fall sein. Die Menschheitsgeschichte post Christum wäre die lächerlichste Geschichte, die sich je zugetragen hat, und mit ihr alle Einzelgeschichten, die sich in ihrem Fiktionshorizont abgespielt haben. Milliarden von Menschen, die ihr Leben ausgerichtet haben auf ein wahnhaftes Jenseits, das ihnen ein psychotischer Tischler verkündet hat.
Mister Spock und seine vulkanischen Modellierer würden, noch während sie danebenstünden und sich das Ganze für ein paar Jahrhunderte ansähen, einfach nicht fassen können, was sich da vor ihren Augen zuträgt. Und irgendwann würden sie es wohl aufgeben, auf irgendwelche Spuren von Rationalität und Zurechnungsfähigkeit unter den Erdlingen zu hoffen, würden in ihr Surak-Forschungsschiff steigen und peinlichst berührt von dannen dampfen.
Aber wer weiß … vielleicht war Jesus ja doch der, für den er sich hielt. Immerhin ist es relativ unbestritten, dass er existierte. Was man von den Vulkaniern nicht mit letzter Sicherheit sagen kann.
© Marcus J. Ludwig 2023
Alle Rechte vorbehalten