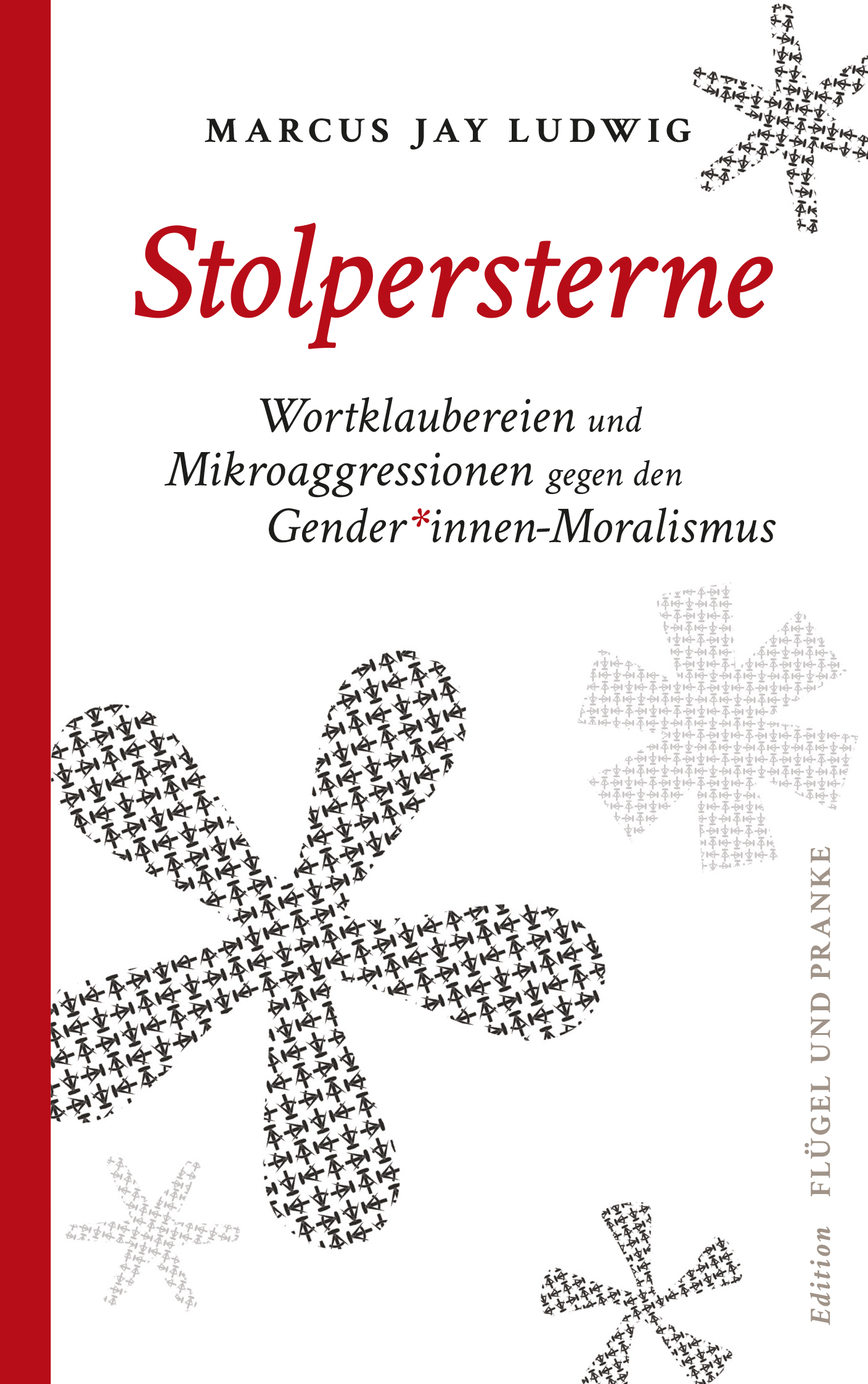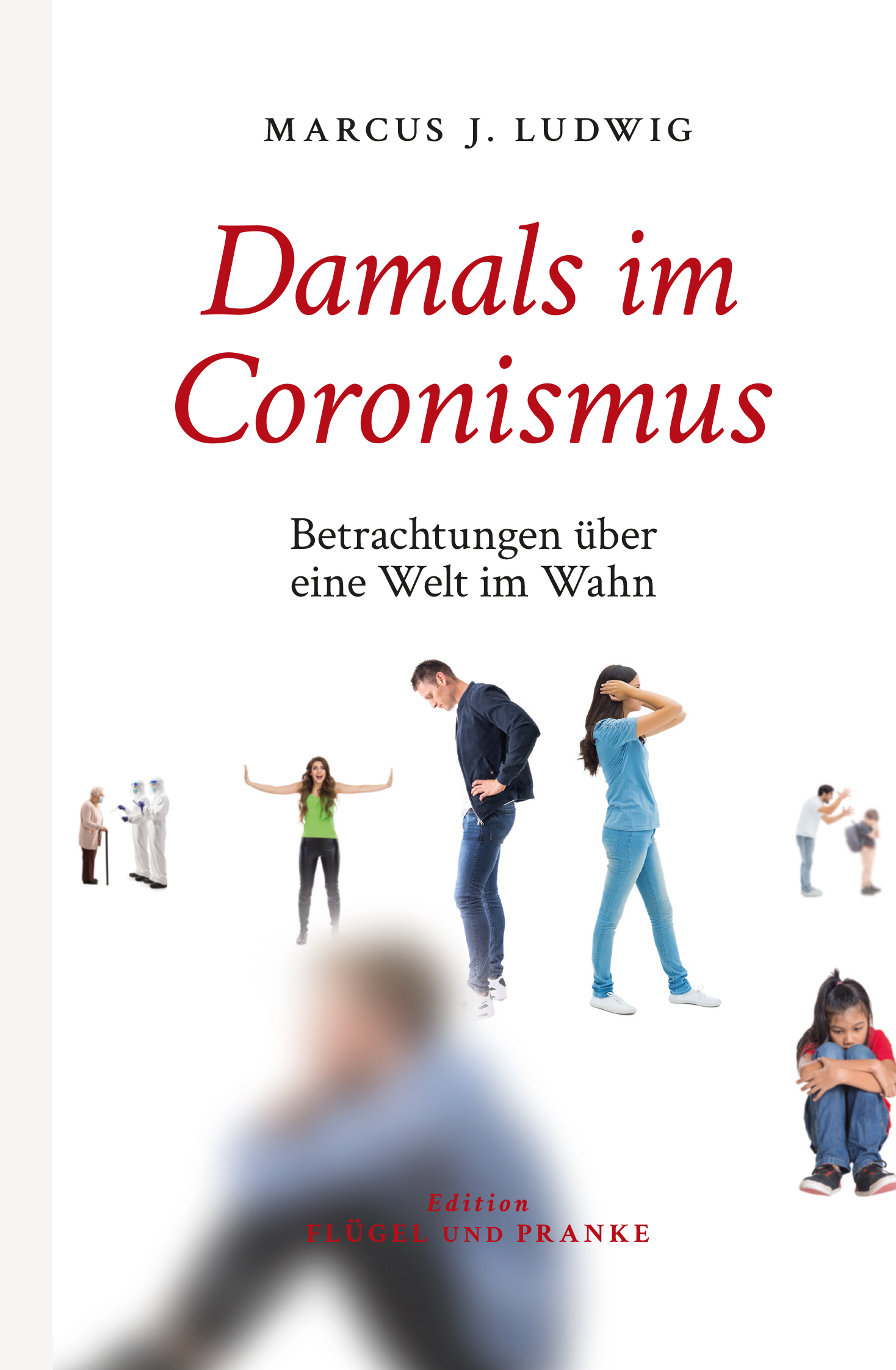Grobnotiertes Gemurmel beim Lesen von Thomas Manns „Betrachtungen eines Unpolitischen“
– – –
Hätte sie singen sollen, diese Seele? TM versucht Nietzsche gegen Georges Verkennung zu rechtfertigen, indem er den Schriftsteller, den Kritiker und Feuilletonisten, den „europäischen Intellektuellen“ als bedeutender verkauft als den Dithyramben-Dichter. Hätte Nietzsche ein noch Größerer werden können, wenn er einen Empedokles gedichtet hätte? Natürlich nicht, gerade das, was er tat, war ja das Außergewöhnliche, Neue und Sensationelle. Aber tat er es denn nicht als Dichter und Sänger? Hört man sie nicht singen, die Seele des Prinzen Vogelfrei, aus jeder Silbe seiner radikal-kritizistischen Prosa? Aus jeder zweiten wenigstens?
Der Kritiker und Psychologe als Poet – gerade das ist ja das immer noch Umwerfende und Erschütternde an ihm, dass alle Erkenntnis, alle raffinierte Enttarnung, alles kulturärztliche Herauspräparieren unbewusster Allzumenschlichkeit bei ihm wie lyrischer Tenor und Geigenflimmern klingt …
Würden sie auch so flimmern, die strengen Genialitäten des Pfarrhaussohns aus Röcken, wenn man sein Leben nicht immer mitläse im Hintergrund? Dies märchenhafte Martyrium, diesen epochalen Opferdienst am Leben gegen die Verlogenheiten einer Welt, die wohl schon damals nicht mehr zu retten, nur noch zu demaskieren und zu verfluchen war. Und wie überirdisch schön er sie verfluchte!
„Seine ‚fortschrittliche‘, zivilisatorische Wirkung besteht in einer ungeheuren Verstärkung, Ermutigung und Schärfung des Schriftstellertums, des literarischen Kritizismus in Deutschland. Es geschah in seiner Schule, dass man sich gewöhnte, den Begriff des Künstlers mit dem des Erkennenden zusammenfließen zu lassen, sodass die Grenzen von Kunst und Kritik sich vermischten.“
Nietzsche als Neuerer, als Lichtträger und Feuerbringer, Prometheus und Luzifer, als aristokratisch-antideutscher Demokratisierer und guter Europäer, als stilbildender Erzieher und Erdbeben der Epoche … zweifellos – aber kannte man 1916, kannte TM schon das Häufchen Elend, den „Herzensfritz“, die Tränen des ewig verschmähten Liebhabers, den errötenden Lehrer, den „gemüthlichen“ Muttersohn, den erotisch prekären Kauz und Schrat, den armen Teufel – Nietzsches Briefe lagen erst sehr selektiv vor, Berichte von Zeitgenossen erscheinen ab 1932, der Briefwechsel der Mutter mit Overbeck kommt erst 1937, die Fälschungen der fatalen Schwester waren noch unentdeckt –, kannte man, mit einem Wort, den Lebensversager neben dem Lebensverherrlicher und -verteidiger? Die Spannung der Gleichzeitigkeit aber ist es, woher das Beben die Energie bezieht, die anhaltende Erschütterung, die durch die Generationen geht. Der Brecher alter Tafeln neben dem Jammerlappen, der Dynamit-Jongleur neben dem pseudo-dionysischen Veitstänzer. Der Zusammenbruch, der Wahnsinn am Ende ist nur die Krönung, und was geht nicht alles vorher an unglaubwürdigstem biographischem Schauspiel?
Wenn deutsche „Filmschaffende“ irgendeinen Sinn für Stoffe hätten, dann hätte sich längst mal einer an eine Nietzsche-Serie gemacht … Netflix-taugliche Titel hat N. ja selbst schon genug geliefert: Zarathustra. Götzendämmerung. Jenseits von Gut und Böse. Morgenröte. Ecce Homo. Aber vielleicht ist es auch besser, wenn sie die Finger davon lassen, denn man müsste wohl damit rechnen, dass N. am Ende wie Heino Ferch oder Tom Schilling mit angeklebtem Schnauzbart aussähe.
* * *
Renate Müller-Buck im Nietzsche-Handbuch: „Während der Arbeit am Antichrist schreibt Nietzsche an Seydlitz: ‚Lieber Freund, das war kein stolzes Schweigen, […] vielmehr ein sehr demüthiges, das eines Leidenden, der sich schämt zu verrathen, wie sehr er leidet. Ein Thier verkriecht sich in seiner Höhle, wenn es krank ist; so tut es auch la bête philosophe … Ich bin jetzt allein, absurd allein; und in meinem unerbittlichen unterirdischen Kampf gegen Alles, was bisher von den Menschen verehrt und geliebt worden ist.‘
Im Vorwort zum Antichrist lesen wir dann: ‚Man muss der Menschheit überlegen sein […] durch Verachtung‘.
Erst eine Lektüre, die beide Pole zusammensieht und die ganze extreme, übermenschliche Spannung dieses Lebens und Denkens im Auge behält, kann ihm in seiner ganzen tragischen Tiefe gerecht werden.“
So ist es.
* * *
Nietzsche … der intime große Ton … ein halbblinder Mann, der sich selbst sein Leben dichtet, sich flüsternd, fiebernd die ungeheuerlichsten Geheimnisse anvertraut … Licht und Schrecken und Finsternis.
* * *
Die Gespaltenheit des Künstlers, das Schizoide des Dichters, des Literaten … der Künstler ist Musiker und Kritiker. Beides, unbedingt. Sänger, Multiinstrumentalist, Mundorganist, immerzu summender, pfeifender Hymniker, immer auch Schauspieler, Comedian, Parodist, Stimmenimitator – auf jeden Fall Rampensau. Auf jeden Fall steht er auf der Bühne, mit Leib und Seele. Das heißt … nun ja, eben nicht mit dem Leib, sondern nur mit der Seele. Und auch die steht nur zeitweise auf der Bühne, denn die andere Hälfte der Zeit sitzt sie im Publikum und schaut sich zu, eben als Kritiker, als Richter in Geschmacks- und Gewissensdingen, als ethisch-ästhetischer Beurteiler. Das ist der Künstler. Ein Mischling, ein Halb-und-halb-Bastard, ein Gespaltener und ewig Unerlösbarer. Die leibhaftige Ironie. Schreiendes Spielkind, Träumerle, fiebrig sich wälzend im Gitterbettchen des Unbewussten, und: strenger Ermittler, unerbittlicher Richter, strafender Zuchtmeister, runtermachend, entmutigend, vernichtend … man schreibt etwas, trällert etwas, man improvisiert und künstlert, es arbeitet in einem, es entsteht etwas, man lässt es geschehen, man lässt sich gehen, man lässt es gehen. Und dann liegt irgendetwas vor, ein Produkt, ein Erguss, ein Ergebnis. Man wundert sich. Was ist das, wo kommt es her, ist das von mir, kommt das aus mir? So so, interessant, lass mal sehen … und dann besieht man, und nach dem Wundern kommt das Sezieren, das Beschneiden und Desinfizieren, das Umbauen, das Retten-was-zu-retten-ist … – Vielleicht ist das aber auch gar nicht Künstlertum, sondern einfach nur Dilettantismus.
* * *
TV-Doku über Uwe Tellkamp. Starker Eindruck. Lange kein Schlaf, angeregt und irritiert, Fragen an mein Künstlertum. Tellkamp, der Künstler im Tageslicht außerhalb des Gehäuses, der Künstler als Bürger, als Choleriker vor der Kamera. Muss man nicht so sein, so unbedingt? Einfach alles raushauen, ungeschliffen, unironisch, anstrengend, verletzlich. Der Künstler als Kind und Kraftmensch. Ganz bei sich, unbeherrscht, wütend und weich bis zur Tränenseligkeit. Scheut sich nicht, bei der Lesung des eigenen Textes zu weinen. Wirkte komischerweise keineswegs peinlich … weil es irgendwie echt war, so märchenecht und rührend rücksichtslos. Wagner. Sachsen. Ein bisschen Kollerigkeit würde mir auch guttun. Die Dinge rauslassen, statt sie endlos zu bebrüten.
Jedenfalls muss man froh sein, dass mal jemand vom Format Tellkamps die Schnauze aufmacht. Wenngleich er unter den vielen, die unter der Verengung des Meinungskorridors leiden, nicht gerade der analytischste und geistreichste ist, er taugt eigentlich kaum zum Vordenker und zur Galionsfigur … seine Ansichten zu dem Thema eher höherer Stammtisch, er hat natürlich recht, aber Rechthaben reicht ja nicht, man muss doch auch schön und intensiv und begeisternd rechthaben. Aber er ist halt der Autor des Turms. Premiumdissident. Man muss halt erst mal Erfolg haben, um skandalös werden zu können.
J. meinte, mit dem müsstest du dich mal treffen. Und nach kurzem Nachdenken: Aber das Gespräch wär wahrscheinlich schnell vorbei, weil ihr euch in allem einig wärt …
Weiß ich gar nicht. Es ist schon ganz hilfreich, dass ich Veganer bin, und allein dadurch immer daran erinnert werde, dass ich mit all den zeitgenössischen Oppositionellen ganz und gar nicht in allem einig bin. Labern lässt sich viel. Gegen die Verkommenheit – schönes Wort übrigens, „Verkommenheit“, trifft ziemlich genau die Mitte zwischen ethischer und ästhetischer Degeneration – gegen die Verkommenheit von FAZ und ZDF zu wettern, ist wohl mutig, man kann eine Menge verlieren dabei. Aber als Frage des Ethos ist diese ganze Meinungskorridorscheiße ja leicht und eindeutig zu beantworten. In Wort und Tat. Was einer aber wirklich taugt, zeigt sich in letzter Konsequenz am Speiseplan. Aber weiß ich denn, ob Tellkamp nicht vielleicht Veganer ist? Er sieht nicht so aus. Aber seh ich so aus? Bin ich nicht schon fast so dick wie der? – Aber, aber, Schluss jetzt mit Gelaber.
Bestellte Das Atelier.
Las Das Atelier.
Erst doof, dann beeindruckend, dann super, stellenweise jedenfalls. Gesamteindruck im Nachhinein: keine Ahnung … einer schreibt, um Sätze zu schreiben, die noch keiner vor ihm geschrieben hat. Klingt alles ein bisschen nach Klagenfurt. Durchgängig anstrengend. Nicht mein Stil, aber halbwegs mein Thema. Theoretisch. Kunst und Künstler, und wenn wie, warum?
Die ganzen minutiös-mikroskopischen Bildbesichtigungen problematisch. Dasselbe Problem wie bei TMs Musikbeschreibungen. Wenn man das Beschriebene nicht kennte, sagten einem diese ganzen Impressions-Verwortungen nicht viel. Die Transformation von Klang in Wort, von Akkord in Wort, von Bild und Farbe und Komposition in Wort bleibt ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn man Neo Rauchs Bilder vor Augen hat und die Art kennt, wie er spricht – „Jetzt muss ich weichen“ – und wie er in seinem riesigen Atelier rumsteht und schafft und schöpfert, dann funktioniert der Text, sonst vermutlich nicht so richtig.
Sehen lernen. Ja, durchaus. Da kann einer sehen, und er kann beschreiben, wie er sehen kann. Lust, mir den Turm vorzunehmen, macht dieses Büchlein jedenfalls nicht. Stelle wieder fest, dass ich eigentlich keine Literatur mag. Was hab ich davon, so ein Buch zu lesen. Ganz nüchtern betrachtet, ist das komplett verschwendete Lebenszeit. Keine Erkenntnis, keine Unterhaltung, nur wieder irgendwas, zu dem man sich verhalten muss, irgendwas, das einen mit Fragen nervt. Mich jedenfalls. Ich kann nichts lesen, ohne nach ein paar Seiten lesen ein paar Seiten schreiben zu müssen.
War nicht immer von „Sprachmagie“ die Rede, wenn von Tellkamp die Rede war? Also früher, als er noch nicht neurechts war? Hat der Bachmannwettbewerb je Zauberer hervorgebracht? Junge Ärzte und Grafikdesigner lesen einem schwitzenden Publikum ihre sperrige Innenwelt vor, man sieht, wie es stinkt in diesem sommerlichen Sonderlingsseminar, die Luft zum Schneiden, die Stimmung zum Kotzen, das Gelese zum Weglaufen; wer sich in so einem Setting verzaubern lassen kann, hat ein ernsthaftes Problem.
Mit dem Atelier würde Tellkamp da locker nochmal gewinnen. Beziehungsweise irgendein Avatar, den er statt seiner dahin schickt, denn als rechter Hater kann er sich solche System-Geselligkeiten wohl für alle Ewigkeit von der Backe putzen.
Bewusstseinsstrom, Einfallsstrom, Solosynchronschwimmen gegen die Strömung der Welt. „Lyrische Reportage“, gut, warum nicht? Achtbar, aber welches Problem bezwingt man damit? Überzeugt man sich damit, dass man zu Recht existiert, dass man sich irgendwann vielleicht doch nicht umbringen muss? Ich lese das und denke dabei fortwährend, dass ich lese und einem anderen Autor beim Schreiben zusehe. Kann ich das auch? Muss ich auch so schreiben? Das Abendlicht auf dem Balkon reicht nicht mehr, um die Buchstaben auseinanderzuhalten. Merke, dass es eigentlich keine Rolle spielt, dann lese ich halt andere Wörter, oder ich lese das schwarzgrüne Geäst und Geblätter und den Rauch, der in Würfeln durchs Katzennetz weht, der Sinn bleibt weitgehend derselbe. Außerdem wacht zehn Meter unter mir gerade keckernd und knurrend und raschelnd die nachtaktive Tierwelt auf. Keine Geschichte der Welt kann es mit dem dämonischen Bestiarium der Dämmerung aufnehmen.
Was genau mache ich hier gerade? Ich sitze und trink meine Pulle Export und rauche in die Nacht. Und weil das irgendwie zu wenig ist für einen wie mich, lese ich nebenbei ein Buch. Und die eine Frage bleibt über dem großen grünen Gebüsch, überm Gestöber der Dachse und dem Gebalze der Nachtvögel: Ist das hier jetzt wirklich mein Leben?
Twice you burned your life‘s work, once to start a new life, and once just to start a fire … wie viele Bücher besitze ich? Zweitausend? Dreitausend? Mindestens fünfhundert liegen ungelesen in Stapeln um mich herum, für die große Nachholzeit, da alles erledigt und geordnet sein wird, und ich mich auf das Wesentliche voll einlassen kann. Aristoteles, Augustinus, Wolfram, Dante, Vasari, Hobbes, Dickens, Mörike, Ibsen, Steiner, Hayek, Klages, Hofmannsthal, Arendt … ich weiß, dass diese Zeit nie kommen wird; alle, die so denken, sterben am ersten Tag ihrer aufgesparten Restzeit. Sobald sie die erste Seite Proust oder William James oder Ebner-Eschenbach oder Wittgenstein umgeschlagen haben, kommt der lächelnde Sensenmann aus dem Dunkel hinter dem Lesesessel herangeschlendert, es macht einmal rrratsch und zzzling und blubber und sicker, und am nächsten Tag klingelt der Antiquar und kauft den Hinterbliebenen fünfhundert ungelesene Meisterwerke der Weltliteratur zum günstigen Gesamtpreis ab, um sie dann gewinnträchtig auf ZVAB zu verticken. Der Arsch.
Vielleicht werden es gar noch ein paar hundert mehr sein. Auf meiner Amazon-Merkliste warten genau sechshundert Bücher darauf, dass ich erbe oder im Lotto gewinne, damit ich sie endlich alle auf einen Schlag kaufen kann. Mehr als sechshundert passen da nicht drauf, deshalb bin ich irgendwann dazu übergegangen, meine Wunschbücher als Bookmarks im Chrome-Favoritenordner „Bücher“ abzulegen. Da liegen jetzt mindestens nochmal sechshundert. Wenn ich den Ordner aufmache und den Runterscrollpfeil gedrückt halte, dauert es etwa drei Minuten, bis das untere Ende erreicht ist. Alles wichtige Werke, die ich gelesen haben muss. Wenn ich sie nicht gelesen haben werde, wird mein Leben umsonst gewesen sein.
Ich träume von einem großen Brand, der mir alle Lesezwänge und Lebensentscheidungen abnähme. Alle Regale und Merklisten und Favoritenordner einäscherte. Ein Feuer, das Tatsachen schüfe und Irrwege abbräche. Neu anfangen. Mit allem. Neu anfangen müssen. Aufhören dürfen mit dem Ausweichen und dem Aufschieben. All die ungelesenen Bücher nicht mehr lesen müssen. All die Dokumente nicht ordnen und abheften müssen. All die Fotos nicht digitalisieren müssen. All die Notizen nicht zu Texten ausarbeiten müssen. All die Romane nicht zu Ende schreiben müssen. Nichts mehr besitzen müssen, das einen auffordernd ansieht, nichts an sich ranlassen, das einem suggeriert, man sei zu Höherem berufen als irgendein Tier. – Der Mensch ist das besitzende Tier. Der Mensch ist das Tier mit zu viel Zeug. Der Mensch ist ein entarteter Hamster.
Erinnere mich, wie ich neulich kurz vorm Einschlafen einmal die Weltformel gefunden habe … die Stellung des Menschen im Kosmos und so. Die Erkenntnis war offenbar so beruhigend, dass ich darüber wegschlummerte. Und sie am nächsten Morgen vergessen hatte. – „Der Mensch ist das Tier, das …“ hm, irgendwas mit Gegenwartslosigkeit und Sinnsimulation … komm nicht mehr drauf.
Frage mich beim Blick in den inneren Spiegel, ob ich wirklich so dick bin wie der Tellkamp? Oder es demnächst sein werde, wenn ich weiter so viel veganes Export süppel und vegane Chips knabber und rumsitze und vegane Zigaretten rauche und doofe Gedanken denke, anstatt dem Rauch zu folgen, endlich vom Balkon hinab zu den grünen Nachtvögeln zu fliegen, in den schwarzen Zauberwald jenseits des Katzennetzes, dort hinunter, in die Unmittelbarkeit, wo die Natur balzt und träumt und sich die magischsten Märchen erzählt.
* * *
Chaotische Naturen finden Beruhigung und Behagen bei Goethe, weil er ins Chaos der Welt Gestalt zu bringen vermag. Der Künstler als Sieger, als Triumphator über die Zumutung der weltlichen und menschlichen Mannigfaltigkeit. Goethe behält den Überblick. Goethe ordnet die Welt, indem er sie gültig ausspricht. Bei Goethe wird alles verzeihlich, weil es endlich und handlich wird. Die Welt wird unterteilt und portioniert in Phänomene, deren Beschreibung gerade so komplex ist, dass man‘s gerade so noch ertragen kann. Größer dürften die Einheiten nicht sein, denn dann wären Sprachgebilde nötig, die für normale Gehirne nicht mehr zu verarbeiten, oder zumindest nicht mehr zu genießen wären. Bei Goethe genießt man das Gefühl, sich im Optimum humaner Komplexität aufzuhalten. Sein Werk ist im Grunde ganz so wie sein Haus.
* * *
Parsifal gehört, in allen Versionen. Abbados Suite. Mickischs Vorspiel-und-Finale-Paraphrase, Henk de Vliegers Orchestral Quest, Humperdincks Piano-Duo, Leinsdorfs Exzerpte, Stokowskis symphonische Synthese. Schönheit, die kaum auszuhalten ist, ein Beben und Aufreißen der Himmel, ein Niederrieseln von Erlösungen, die einen untauglich für jeden Alltag machen. Ach, dieser Zauberer und Oberkirchenrat, dieser Friseur und Protohitler, dieser Meister und Vollender in Plüsch und Seide, dieser geschwätzige Gott und Giftmischer, dieser große Liebende, der tränenblind schluchzend durch den Garten irrt, nach seinem toten Hunde rufend, dieser reichlich Gebende und Nehmende, dieser übervolle Mensch, dem ich immer wieder doch alles verzeihen muss. Zumindest solange ich unter dem Einfluss seiner Drogen stehe.
Natürlich ist Nietzsche der Größere und der mir bei Weitem Nähere, und wenn Wagner ihm wie einem besseren Dienstboten Bestellungen für Unterwäsche durchgibt, möchte man ihm noch 150 Jahre nachträglich seine Festspielscheune abfackeln und seine sämtlichen Partituren ins Feuer werfen; und wenn er Nietzsches Arzt über dessen Sexualleben aushorcht und ihm seine Hypothesen über Onanie und Päderastie einflüstert, stimmt man hasserfüllt ein in alle Verwünschungen und Widerlegungen und Entzauberungen, die der gequälte Psycholog an dem Luxusmusikanten vornimmt.
Muss man sich denn zwischen beiden entscheiden? Man muss halt sehen, dass Wagner alles mögliche war, unter anderem ein großer und unbekümmerter Abenteurer und Witzbold, ein rücksichtslos Lebendiger, Hasardeur und Heulsuse, Randalierer und Kneipenschwadroneur, während Nietzsche wohl wirklich nicht sehr humorvoll war, weil er natürlich auch nicht viel zu lachen hatte, auch wenig Gelegenheit hatte, es zu lernen, immer leidend, immer verklemmt und gehemmt, immer sich und die Welt überwinden müssend.
Aber so muss man eben sein, so willig zu tödlicher Verletztheit, so lüstern nach dem Kreuze, um schließlich zum Heiligen zu werden, während Wagner, Goethe ähnlich, nur zum Gotte wurde. Allerdings nicht zum Olympier, sondern zu irgendetwas Irdischerem, Deutscherem und Dämonischerem, zu einem Wotan halt, einem Göttervater im gesteppten Schlafrock.
Nietzsche aber ist verewigt als der letzte frohe Botschafter und Blutzeuge, der wohl letzte wirklich heilige Mensch, der auf Erden wandelte, der letzte, von dem wir wissen, zumindest. Und ach, was wissen diese erbärmlichen Katholiken mit ihren sanktifizierten Pontifexen von Heiligkeit!
Wenn die Priester, die Bischöfe, diese ganzen 2.0-Kirchentagschristen nicht solche grünlichen Zeitgeist-Follower, solche linkischen Krückenhändler und farbenfrohen Botschafter wären, könnte ich glatt wieder katholisch werden. Ich könnte Katholik sein ohne Gott. Allein wegen Jesus und wegen der Schönheit all dessen, was katholische Frömmigkeit an Werken hervorgebracht hat über die Jahrhunderte. Aber ich kann es nicht, solange Katholischsein heißt, sich mit diesem albern-abominablen Menschentypus zu vergemeinschaften.
* * *
Europa? Ja, ein für alle Mal und endgültig: Europa! – Deutschland, „das Land der Deutschen“ ist verloren. Nichts scheint notwendiger – und mittlerweile auch irgendwie natürlicher – als ein echtes, lebendiges, ein zur Realität erwachtes Europa. Also das Gegenteil einer Union, einer konstruierten Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, eines rein funktionalen Bürokratengebildes. Wir brauchen den Staat Europa, die Willensrepublik Europa, den zur politischen Einheit gereiften Sprach-, Geschichts- und Kulturraum Europa. Wir müssen das werden, was die Schweiz seit Jahrhunderten bereits exemplarisch und erfolgreich ist: eine Eidgenossenschaft.
Ein Kontinent, ein Volk, eine – was denn sonst: Schicksalsgemeinschaft. Unser Schicksal ist unser Herkommen aus dem Abendland und unsere Zukunft als Hochburg säkularer Humanitas, als Hort und Zufluchtsort des freien, rational-aufgeklärten, souveränen Menschentums. Kein Sacrum Imperium, vielmehr ein Reich des Realismus, das gleichwohl auch seine Art von Heiligkeit haben muss – es wird schon Helden brauchen, die sich opfern dafür …
Unsere halbinsulare Heimstatt, diese etwas in die Jahre gekommene „besondere“ Immobilie – Königshalle, Kulturpalast und geopolitisches Reihenendhaus – kann Bestand haben, es lohnt die umfangreiche Renovierung, aber nur hin zu einem gemeinsamen, föderalen Staat, frei im Innern, Festung nach außen. Burg für Bürger, Biotop und Habitat, Schutz- und Entfaltungsraum für eine Lebensform, die durch neue Bewusstwerdung, neue Begeisterung am Leben erhalten, meistenorts wohl erst wieder ins Leben gerufen werden muss.
Vielleicht ist es gegen die Gesetze der Geschichtsmorphologie, den Untergang aufhalten zu wollen, das Absterbende künstlich am Leben erhalten zu wollen, aber ist es nicht das Wesen europäischen Geistes immer gewesen, der Natur und ihren Gesetzen gegen jede Wahrscheinlichkeit das Allerunwahrscheinlichste des Universums, die Kultur, abzutrotzen? Die Hochkultur vom Petersdom über den Parsifal bis zum Porsche 901 durchzusetzen, vom Genter Altar bis zum Zauberberg, gegen die Negationskräfte der Physik, gegen Pest und Cholera und gegen die Zerstörungsgelüste im eigenen Innern?
Europa kann nicht nur überleben, es kann sogar gerade jetzt erst anfangen zu leben. Sofern es das will. Allerdings muss Brüssel erst einmal gründlich zerstört werden. Nicht die Stadt natürlich, sondern die … ich wollte schon sagen: „die Idee“, aber das Brüssel-Europa eine Idee zu nennen, nähme sich inmitten solch pathetischer Aufbruchsfantasien unangemessen sarkastisch aus … sagen wir also: das Malheur Brüssel, die Missgeburt und Fehlleistung, das peinliche Projekt, diese dumme Sache, über die wir nicht weiter reden wollen, sie also muss zerstört … was heißt „zerstört“ – geräuschlos beendet und vergessen werden muss sie.
Neue Hauptstadt kann nach Lage der Dinge eigentlich nur Zürich werden. Erstens, weil die Schweizer nun mal wissen, wie das geht mit der Eidgenossenschaft und der gedeihlichen Koexistenz verschiedener Volksgruppen in einem Staat; weil, zweitens, Zürich, weil die Schweiz immer schon die Seele Europas war, immer schon der Ort war, wohin es all jene Europäer zog, die aus ihren durchgeknallten Heimatländern ins echte und unerschütterliche Kernland bürgerlicher Kultur fliehen mussten; und drittens, weil man den Schweizern wohl schlichtweg etwas bieten muss, damit sie überhaupt mitmachen im neuen „Abendland“, „Hesperien“, „Westreich“, whatever. Man kann Europa ja nun nicht in failed states wie Belgien, Deutschland, Frankreich neu starten.
Ich schrieb schon andernorts, dass die Grundvoraussetzung für ein zum Staat geeintes Europa die natürliche Zweisprachigkeit sein müsse: „Bilinguale Erziehung muss eine Selbstverständlichkeit sein. Ohne die sichere Beherrschung der Verkehrssprache Englisch gibt es kein vereintes Europa. Schulenglisch reicht nicht, es muss nuanciertes, natürliches, ab dem ersten Lebenstag neuronal einverleibtes Englisch sein. Es war mir schon immer und ist mir noch immer unbegreiflich, dass dieses Thema nie eine Rolle im Europadiskurs gespielt hat. Die Vorstellung, man könne ein multinationales Gemeinwesen über die Wirtschaft und die Währung organisieren, ist an psychologischer Ignoranz und soziobiologischer Stupidität schwer zu überbieten. Solange ein Grieche und ein Ire – ob Straßenkehrer oder Staatschef – nicht in derselben Sprache diskutieren, streiten, schimpfen, witzeln, fluchen, spotten, trauern und träumen können, so lange gibt es keine europäische Öffentlichkeit, keine europäischen Bürger, keine europäische Identität.“
Warum dann aber gerade die Schweizer zum Vorbild taugen sollen, sei nicht recht ersichtlich, könnte man da einwenden. Denn die schaffen es doch auch, vier Landessprachen in einem Staat unterzubringen.
Nun, bei der Schweiz kommt – historisch, mythisch, naturbedingt – dasjenige Element hinzu, zu dem Europa sich erst per Geistesblitz und Kraftakt entschließen müsste: der Wille zur Verteidigung der eigenen Singularität, der Stolz auf unvergleichliche Errungenschaften, und daraus resultierend: der Wille zur Festung. Die Schweiz wird psychodynamisch unter dem Druck äußerer Kräfte zusammengehalten. Die Lage als Felseneiland im Innern Europas, inmitten bedrohlich heranwogender Riesenreiche, formte diesen einmaligen Gesellschafts- und Mentalitätsgipfel, gegen alle Fliehkräfte. Gegen alle Sprach-, Klima-, Konfessions-, Kulturfaktoren stabilisierten sich halbfremde Ethnien auf höherer Ebene zur genuin europäischen Form menschlicher Vergesellschaftung: zur Bürgerschaft. Die Bürgerschaft ist jener Typ von Gesellschaft, deren Teilnehmer mehr sind als bloße Shareholder, nein, nicht nur mehr, sondern etwas wesensmäßig anderes, denn eine Burg ist kein Unternehmen. Bürger sind keine Gesellschafter. Wer eine Burg – also ein auf Dauer und Sicherheit angelegtes Staatsgebilde – bewohnt, gestaltet, unterhält und im Notfall auch verteidigt, der hat anderes im Sinn (und im Herzen) als ein Aktionär oder Teilhaber, der sich zu Businesszwecken mit anderen zusammentut. Der Bürger hat nicht teil, er ist Teil.
Dieser Anspruch auf begrifflich-beiklangliche Präzision ist nicht unerheblich. Man male sich ein Land aus, wo in jedem Text, jedem Gespräch, jeder Doku, jeder Parlamentsdebatte, jeder Nachrichtensendung „Bürgerschaft“ statt „Gesellschaft“ gesagt würde …
Ist die Schweiz im Hinblick auf die geo-psycho-politischen Strömungsverhältnisse eine Insel, so gleicht Europa in jeder Hinsicht einer Halbinsel. Druck kommt von drei Seiten, Zug und Sog von einer. Und diese eine ist psychodynamisch die problematischere, weil ambivalentere: Europa ist nicht nur geografisch zum Atlantik offen, sondern vor allem mental, zur atlantischen Utopie, gewissermaßen. Amerika, die neue Welt, Nova Atlantis, unterhält noch immer mit glänzenden Versprechen die Sehnsüchte des altersschwachen, seiner Menschheitsverpflichtungen überdrüssigen Kontinents. Der American Dream, dieser schöne Schlaraffen-Wahn vom ewigen Westen mit seinen unbegrenzten Happiness-Potentialen, ist für die, die ihn niemals werden leben können, für die daheim zurückgebliebenen Alteuropäer, noch viel fantasiebeflügelnder als für jeden Tellerwäscher aus Beaver Creek.
Solange die Atlantikbrücke offensteht, solange die Europäer kulturell, militärisch, wirtschaftlich, wissenschaftlich, vor allem aber wunschtraum- und unterhaltungsindustriell, täglich über diese Brücke zur Arbeit – also zur Bastel-Arbeit am Bewusstsein – pendeln können, kann Europa nicht wieder europäisch werden. Es bleibt in jeder Hinsicht ein Anhängsel, oder besser: ein „Abhängsel“ der USA. Wie diese atlantische Seite neu zu gestalten wäre, dürfte wohl die schwierigste Frage bei der Renovatio Europae sein.
Die anderen drei Seiten – Russland, Vorderasien (Israel ausgenommen), Afrika – sind dagegen festungstechnisch relativ klar: Mauern, Grenzen, Wälle, Cordons, Sicherheitszonen, Wacht, Patrouille, Abwehr. Was davon man physisch bräuchte und was nur mental, rechtlich und verfahrenslogistisch, würde sich im Lauf der Zeit zeigen.
Der Staat Europa jedenfalls wird nur als Festung Europa entstehen und bestehen können.
* * *
Und die Nationalstaaten? Es leuchtet nicht direkt ein, da die etablierte Begriffsverwirrung wohl einer größer angelegten semantischen Entwirrung bedarf (welche in näherer Zukunft zu leisten sein wird), aber die Nationen werden natürlich erhalten bleiben. Also, so lange zumindest, wie sie sich natürlicherweise am Leben erhalten können. Und wenn sie sich auflösen, muss man sie auch nicht künstlich und gewaltsam am Leben erhalten. Nationen sterben aus, genau wie Familien aussterben. Man darf das betrauern, aber man muss sich irgendwann einfach damit abfinden.
Die Nation ist nicht der Nationalstaat, ist auch nicht das Volk, die Traditionsgemeinschaft oder was immer ihr schon synonymisch angedichtet wurde. Die Nation ist das biologisch-historische Menschengeflecht, welches unter den rahmenden und bindenden Einflüssen von Sprachen, Kulturen, politischen Grenzen, in relativer Isolation also, über Jahrhunderte zu einer großfamiliären Struktur herangewachsen ist, was sich auch – erstaunlicherweise noch immer – ganz zwanglos an sichtbaren physiognomischen Eigenheiten erkennen lässt, sofern man nicht mit ideologischer Blindheit, ober besser: vorsätzlicher Wahrnehmungsunwilligkeit geschlagen ist, was heutzutage allerdings die allermeisten durchaus sind.
„Nation“ ist ein biohistorischer Typus – so wie auf anderen Komplexitätsniveaus Stamm, Rasse, Familie, Ethnie –, ein Typus, um den herum sich allerlei lebensstilistische Charakteristika, Spezifika, Eigentümlichkeiten gruppieren, deren Gesamtheit man dann eben mit altbewährten, zuweilen übermäßig stereotypen, aber meist doch den Wesenskern irgendwie treffenden Etiketten benennt: deutsch, spanisch, polnisch, griechisch, etc.
Der Staat dagegen ist eine Fiktion. Er ist abhängig vom Willen und vom Glauben seiner Bürger. Der deutsche Staat kann von jetzt auf gleich aufhören zu existieren, wenn die entscheidenden Mächte ihm die Zustimmung zum Dasein entziehen. Durch Verträge und Unterschriften beginnt und endet ein Staat, Beispiel DDR. Sie war Realität, solange Menschen die Fiktion glauben wollten. Aber ihr entsprach niemals ein echtes, dingliches, substanzielles Substrat.
Der Staatsbürger ist ebenfalls eine Fiktion. Er ist ebenfalls ein bloßes Als-ob. Ein Außerirdischer, oder auch ein Ur-Irdischer, ein unverfälschter Naturmensch, der so etwas wie Staaten nicht anerkennt, erkennt auch den Staatsbürger nicht an, selbst wenn er Dokumente mit Stempeln und Hologrammen vorweisen kann, die ihn amtlich als Staatsbürger ausweisen. Es ist eine Frage des Glaubens an die Verbindlichkeit von Konventionen, Regeln, Gesetzen, Sprech- und Schreibakten, es ist der Wunschglaube an die Eigentlichkeit des Uneigentlichen, was dem Fiktiven seine illusionäre Macht verleiht.
Was bleibt, wenn der Glaube schwindet? Der Mensch, der gerade noch behördlich beglaubigter Staatsbürger war, steht ja als biologisches Wesen, als Homo sapiens, noch immer da. Er ist real. Das Land, das gerade noch staatlich verfasst war, liegt als geologische Masse, als Boden und Landschaft noch immer an Ort und Stelle. Es ist real. Aber ist es als „Deutschland“ real? Und ist der „Deutsche“ real?
Das Land als umgrenztes, amtlich kartiertes Territorium ist eine Fiktion. Grenzen werden verschoben, lösen sich auf, was eben noch Deutschland war, kann morgen Frankreich sein. Das Grundstück „Elsass“ ist weder wesenhaft deutsch noch wesenhaft französisch. Wenn alle europäischen Staaten sich – bedingt durch welchen neuen Glauben, welche überzeugende Erzählung, welche große Fiktion auch immer – auflösen, um fortan nur noch Europa zu sein, dann gibt es noch immer ein Territorium, auf dem Deutsche leben, Menschen, die durch Sprache, Kultur, Aussehen, Eigenheiten und Wesenheiten irgendwie typisch und von anderen unterschieden sind, aber dieses Territorium ist dann nur noch so etwas wie eine Gegend, eine Sphäre, ein Kulturraum, es sind – wie in frühen, fernen Zeiten – eher „die deutschen Lande“ als ein geodätisch und völkerrechtlich konturiertes „Deutschland“.
Wenn die Deutschen fortfahren, sich abzuschaffen, dann wird Deutschland irgendwann halt Türkland sein, und man wird dann nicht sagen können, es sei eigentlich immer noch Deutschland. Es gibt nichts Eigentliches auf der Ebene des Staates, und auch nicht auf der Ebene des Landes. Das Eigentliche und Reale, das, was es wirklich gibt, das, was da ist, auch wenn wir uns weigern, daran zu glauben, ist die Nation. Und wenn sie weg ist, dann ist sie wirklich weg.
Zurück zur Nation hieße folglich: Zurück zur Natur. Daran mag man als Romantiker Gefallen finden. Aber das Politische muss sich von aller Romantik befreien. Als politische Wesen, als echte Bürger, müssen wir Abschied nehmen von der Nation als Basis der Staatsfiktion. Eine glaubhafte Begründung des multinationalen europäischen Staates muss von anderen als naturgeschichtlichen Grundlagen ausgehen: nein, nicht von irgendwelchen „gemeinsamen Werten“, sondern von Ideen und Idealen. Europa ist kein moralisches, und auch nur in zweiter Linie ein politisches, zuvörderst aber ein ästhetisches Projekt. „Unser Kontinent soll schöner werden.“ Wie wird er das? Indem er wird, was er ist. Indem er mit seiner Idee identisch wird.
* * *
Aber so weit sind wir noch nicht. Entscheidend – ich wiederhole – ist zunächst die Einsicht, dass die Nation nicht der Nationalstaat ist. Es hat sich in den allermeisten Köpfen diese begriffsverwirrende Abkürzung etabliert, etwa nach demselben Muster wie beim Automobil, welches ja korrekterweise nicht „Auto“, sondern „Mobil“ genannt werden müsste, oder wie beim Nationalsozialisten: der Nationalsozialist ist ja auch nicht in erster Linie „Nazi“, also ein „nazional“ oder gar „nazionalistisch“ orientierter Mensch, sondern zunächst mal ein „Sozi“, ein Sozialist. Der Sprachgebrauch entwickelt sich selten nach den Gesetzen von Logik und Semantik. Das ist so lange okay, wie es nur um Sachen wie Autos geht. Wenn Wörter – Wörter als Lautgestalten und Schriftzeichen – aber ganze Gedankenwelten repräsentieren und Einsichtsmöglichkeiten kanaliseren, dann müssen wir auf gewissen Korrektheiten bestehen, sonst ist jedes diskursive Vorankommen, jedes Streiten um stabilere Erkenntnis fruchtlos.
Der Nationalstaat ist die Art von Staat, in dem eine Nation sich zu einem „Status“ verfestigt hat, verfasst hat, geordnet hat. Der Staat ist die Gesamtheit aller Einrichtungen, die eine menschliche Großgruppe oberhalb der Stammesebene sich verordnet, um aus einem ungeordneten fluiden Leben ein „stationäres“ ein „statisches“, ein „staatliches“ zu machen, das auf Dauer, Stabilität, Ordnung angelegt ist. Die Nation ist gewissermaßen die Familie. Der Nationalstaat ist die Familie, die auf dem „Standes“-Amt und beim Notar ihre Formalitäten geregelt und unterschrieben hat.
Der Wille zum Staat, der Wille zur Form also, zur Rechtsform, gehört in eine andere Sphäre als die Liebe zur Nation. Wir dürfen mit unsrer Kinderseele unsere Familie und unsere Nation lieben. Als Erwachsene müssen wir nüchterne, rechtskräftige, zurechnungsfähige Vertragspartner sein: Bürger.
Auf dem besagten „Standes“-Amt können übrigens auch mehrere Familien oder auch nichtfamiliäre Gruppierungen ihre Zusammengehörigkeit unterschreiben, dann entsteht etwa ein Vielvölkerstaat (der eigentlich Vielnationen-Staat heißen müsste), eine Eidgenossenschaft oder auch mal ein Vatikan.
Der Vatikan ist keine Nation. Die DDR war keine Nation. Und die Schweiz ist auch keine Nation. Sie wird gern als Willens-Nation bezeichnet, aber das ist so unpräzise wie alles, was in diesem Bereich bezeichnet und behauptet wird. Die Schweiz ist ein Willens-Staat. Ein Staat, der aus diversen historisch-kulturell miteinander verflochtenen Abstammungsgemeinschaften besteht, die durch den Willen zur gemeinsamen Ordnung zusammengehalten werden. Tatsache aber bleibt, dass sich viele Baseler wohl leichter in Lörrach integrieren könnten als in Lugano, und viele Genfer in Lyon vielleicht besser zurechtkommen würden als in St. Gallen. Nur eine Minderheit der Schweizer kann sich in mehreren der offiziellen Landessprachen verständigen.
Mir scheint, ich habe hinreichend hymnisch bekannt, dass mich das Schweizer Modell staatlicher Ordnung erstrebenswerter, menschenwürdiger und als Werk tätigen Bürgergeistes weitaus schöner dünkt als ein ethnisch homogener Staat wie etwa Japan, aber eine „Nation“ ist die Schweiz trotzdem nicht. Die Schweiz, das ist der Staat in seiner prächtigsten und humansten Erscheinungsform: als Eidgenossenschaft! Menschen, die einander einen Eid schwören, dass sie als Genossen – als Lebens-, Kampf-, Leidens- und Glücksgenossen – Gemeinschaft halten wollen. Die eidgenössische Bürgerschaft als pathetisch ästhetisierte Sozialkonstruktion, das ist die Form menschlicher Vergemeinschaftung, in der Staat, Gesellschaft, Kultur optimal integriert sind. Hier liegt die Zukunft Europas.
Der nationale Weg bleibt dagegen reine Romantik, letztlich Naturromantik. Niemand liebt die Romantik mehr als ich, aber mit ihr ist kein Staat zu machen. Sie ist das Antistaatliche, das Antistatische schlechthin. Sie ist Rausch, Nacht, stürmischer Wolkenflug und Wagnersche Giftmusik. Herrlich, himmlisch, aber nicht irdisch. Das Maximum, das wir uns zugestehen dürfen, so wir „der Erde treu bleiben“ wollen, ist eine lebensbürgerlich eingehegte Romantik: Kindheitsverzicht, Sublimation, melancholisch-produktive Selbstbezähmung, jenes Abenteurertum im Diplomatendress, das uns in Thomas Mann seinen beispielhaftesten, heroischsten Exponenten vorhält.
Wenn Ihnen dieser Text gefällt oder sonstwie lesenswert und diskussionswürdig erscheint, können Sie ihn gern online teilen und verbreiten. Wenn Sie möchten, dass dieser Blog als kostenloses und werbefreies Angebot weiter existiert, dann empfehlen Sie die Seite weiter. Und gönnen Sie sich hin und wieder ein Buch aus dem Hause Flügel und Pranke.
© Marcus J. Ludwig 2022
Alle Rechte vorbehalten