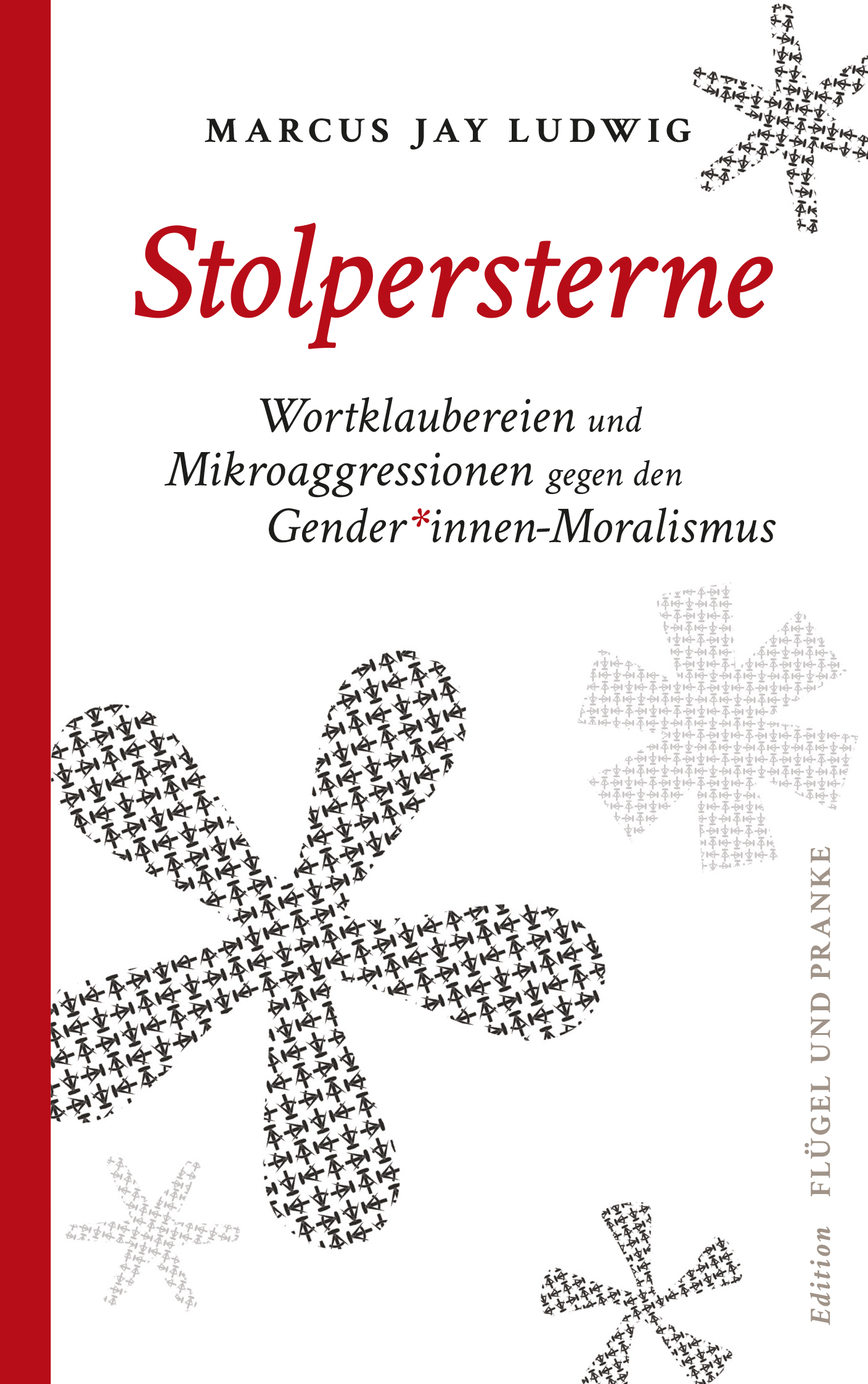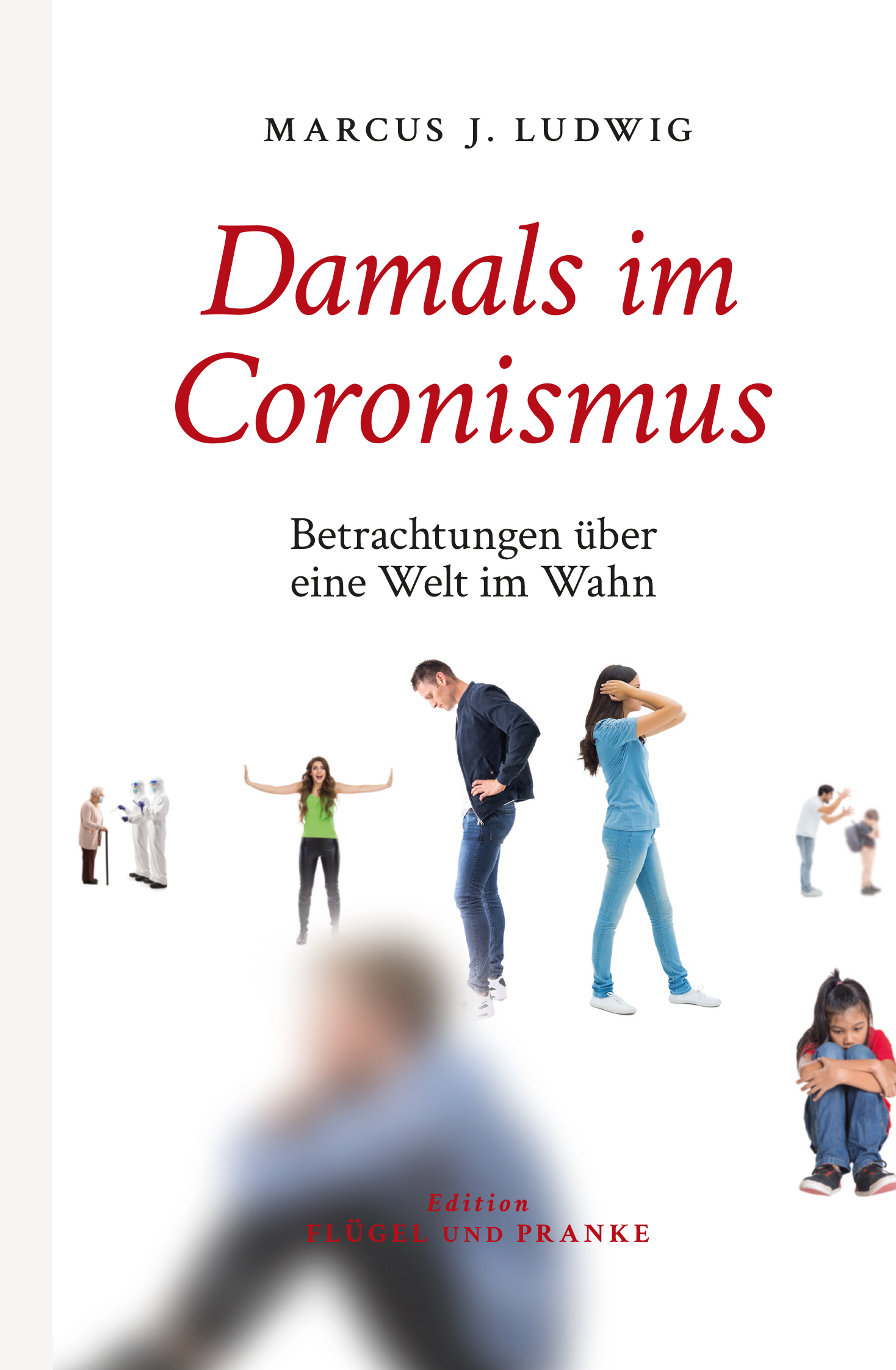Halleluja, Hosianna und Hochdietassen! Ein Wunder ist geschehen, und ich war Zeuge! In einer deutschen Talkshow fand eine echte Diskussion statt! So richtig derbe, mit schwellenden Halsschlagadern, Augenrollen himmelwärts und vor Ingrimm bebenden Extremitäten. Vor allem aber mit einer kontrahentischen Ausgewogenheit, die man überhaupt nicht mehr gewohnt ist: Zwei gegen Zwei! Kein Witz. Und das Ganze moderiert von einem Moderator, der durch ein glückliches Double-Bind einigermaßen gehindert war, sich – wie etwa am legendären 2. Juni 22 [1] – mit gleichgesinnten Gästen zum diskursiven Gangbang zu alliieren, um einer andersdenkenden, andersabwägenden, andersargumentierenden Teufelsbuhle das freche Hexenmaul zu stopfen. Nein, in der Sendung vom letzten Donnerstag [2] saß neben Markus Lanz sein Podcast-Partner Precht, und den konnte er irgendwie schlecht derart Guérot-mäßig verhackstücken, obwohl dessen neues Buch ihm und seinesgleichen offenbar ziemlich die Leviten bläst, ich meine, auf den Schlips pinkelt, ich meine, an die Karre disst, oder wie immer man das heute nennt. „Offenbar“ sage ich, denn ich hab das Werk noch nicht gelesen, und ich weiß auch nicht, ob ich mich nach Prechts peinlichem Elaborat über die Pflicht [3] dazu noch überwinden kann … spielt aber auch keine Rolle für die folgenden Anmerkungen, denn ich rede nicht über das Buch, auch nicht über Precht, nicht einmal über die Sendung als solche, sondern über das Welt- und Selbstbild von Leitmedienjournalisten.
Also, es saßen bei Lanz der erwähnte Leitphilosoph und der ähnlich populäre Harald Welzer, welche zusammen ein Buch namens „Die vierte Gewalt“ geschrieben haben, in dem sie die Selbstgleichschaltung, pardon: Selbstangleichung der Mainstreammedien kritisch betrachten und sozialpsychologisch zu erklären suchen. Und es saßen da als Vertreter und Verteidiger des maximalseriösen Qualitätsjournalismus: Melanie Amann vom Spiegel und Robin Alexander von der Welt.
Es lohnt sich unbedingt, diese 75 Minuten Medien- und Mentalitätsgeschichte aufmerksam über sich ergehen zu lassen [4], denn wo die Nerven derart blank liegen, ist nicht nur für gute Unterhaltung gesorgt, es eröffnen sich naturgemäß auch höchst lehrreiche Einblicke in das Selbstverständnis jenes Menschentypus, dem wir – aus meiner Sicht – den Großteil unserer heutigen Probleme zu verdanken haben. Denn unsere gesellschaftlichen Probleme resultieren beinahe sämtlich aus der Entkoppelung von Realität und Medienrealität.
00:11:53
„Sie müssen aber mit dem Empfängerhorizont rechnen“, meint Amann zu Precht, nachdem der sich mehrfach über erfundene Sätze beschwert hat, die gar nicht im Buch stehen. Solche Pingeligkeit will Amann nicht gelten lassen: „Wenn ich einen Artikel schreibe, ist der in der Welt. […] Und ich muss akzeptieren, dass das auf gewisse Weise interpretiert wird.“
Im Grunde reicht dieses eine Statement schon zur kompletten Problemdiagnose aus: Für Melanie Amann sind die sprachlichen Äußerungen von Menschen wie der Wolkenhimmel – jeder darf darin erkennen, was ihm beliebt. Guck mal, ein Schäfchen, und da: ein Elefant mit zwei Rüsseln, dort, das sieht aus wie ein umgedrehtes Matterhorn, und da hinten fliegt Adolf Hitler!
Melanie Amann ist egal, ob ich auch Hitler sehe, oder ob ich vielleicht Charlie Chaplin sehe, und vor allem ist es ihr egal, ob die Wolken von der Seite oder von oben vielleicht völlig anders aussehen, und erst recht egal ist ihr, woraus die Wolken real bestehen. Sie sieht, was sie sieht, und wir müssen das akzeptieren.
Die parlamentarischen und außerparlamentarischen Oppositionellen können sagen, was immer sie wollen, sie können Gandhi, Schweitzer oder Sophie Scholl zitieren – innerhalb des Empfängerhorizonts der Leitmedien hört es sich immer so an, dass sie nach einem neuen Hitler schreien, dass sie Viren leugnen, dass sie Schwule, Schwarze und Frauen hassen und in ihren Prepperkellern für den Tag X trainieren. Ist halt Interpretationssache. Muss man akzeptieren.
00:32:25
Frau Amann zählt auf, wer alles beim Spiegel und sonstwo seine skeptische Position zu Waffenlieferungen an die Ukraine darlegen durfte, Wagenknecht, Kretschmer, Stegner, Gysi, und und und. „Dass diese Meinungen nicht zu Wort kommen, […] das ist wirklich objektiv falsch.“
Und natürlich merkt Frau Amann nicht, dass dieses altbekannte und ad nauseam bemühte Argument Teil des Problems ist (also nicht des Ukraine-Problems, sondern des Öffentlichkeits-Problems): Es kommen doch alle zu Wort, man kann doch alles sagen, nichts wird unterdrückt, jede Meinung zu einem Thema kann öffentlich artikuliert werden.
Tja ja, nur muss der Meinungsartikulierer dann auch mit den Konsequenzen klarkommen. Und die Konsequenz besteht – anders als eine gewisse Frau Merkel einmal meinte – eben nicht mehr nur darin, dass einem mit durchdachten Argumenten widersprochen wird, sondern darin, dass man heutzutage mit Antimainstream-Positionen mindestens „umstritten“ ist (das heißt: moralisch fragwürdig, intellektuell unterbelichtet, höchstwahrscheinlich aber Aluhut- oder AfD-affin), dass man aus Parteien oder Verlagen oder Unis oder Buchpreisjurys rausgeschmissen wird, oder dass man sich fortan nur noch mit Personenschutz auf die Straße begeben kann.
Wer aber sind diejenigen, die Abweichlern das Label „umstritten“ um den Hals hängen? Wer sind diejenigen, die Konsensstörer zu Nazis und Menschenfeinden stempeln, und damit die Schwelle für Bedrohungen und Tätlichkeiten guten Gewissens herabsenken? Und wer sind noch gleich diejenigen, die zum Beispiel auf die Mitarbeit von Ulrike Guérot in der NDR-Sachbuchpreis-Jury verzichten, „weil sie sich mit öffentlichen Äußerungen von den Werten der wissenschaftlichen Gemeinschaft entfernt hat“? [5]
Wer, Frau Amann, erzeugt in diesem Land ein Klima der Einschüchterung, das dafür sorgt, dass Menschen sich dreimal überlegen, ob sie das, was sie denken, auch wirklich äußern sollen? Irgendeine Ahnung?
00:33:00
Richtig interessant wird es aber, wenn Melanie Amann ins Grundsätzliche geht und fragt: Woher wissen wir alle eigentlich, was die öffentliche Meinung ist?
Mit dieser Frage antwortet sie auf die merkwürdige – aber offenbar verbreitete – Grundannahme, es sei wünschenswert, dass die veröffentlichten Meinungen anteilsmäßig so genau wie möglich die im Volk vertretenen Positionen abbilden. Wenn 50 Prozent der Bürger für und 50 Prozent gegen irgendetwas seien – Sanktionen, Atomkraft, Veggieday, Todesstrafe, whatever – dann, so die Idealvorstellung, sollte sich dieses Verhältnis in den Meinungsbeiträgen und Kommentaren der Medien widerspiegeln. Man müsste also zu jedem kontroversen Thema erst einmal repräsentative Meinungsumfragen machen, und dann müssten die Medien untereinander abkaspern, wer wie oft welche Position publizieren darf, oder so. Das fordert – so weit ich sehe – niemand, weil es natürlich auch völliger Blödsinn wäre.
Anders herum wird aber durchaus gefordert, dass bestimmte Sonderlingspositionen nicht mit den gleichen Anteilen in Talkshows vertreten sein dürften wie solche, die von der „überwältigenden Mehrheit“ seriöser Menschen vertreten werden. Wenn 90 Prozent der Wissenschaftler Corona für ein Killervirus halten und 10 Prozent da eher skeptisch sind, dann könne man ein Podium doch nicht mit 5 gegen 5 besetzten. Solch eine false balance würde ja den Eindruck erwecken, dass die skeptische Position genauso ernst zu nehmen sei wie die vernünftige, seriöse, populäre, regierungskonforme Herden… ich meine Mehrheitsmeinung.
Aber da die Meinungen heute offenbar zwanghaft an bestimmte „Identitäten“ gekoppelt sind, muss die Frage nach der Repräsentativität der Presse entsprechend gestellt werden: Soll für jede Art von Besonderheit, für jede Art von biographischem Handicap, somatischer Abweichung oder ontogenetischer Privilegiertheit ein Quotenmensch in jedem Ressort einer Zeitung sitzen? Melanie Amann weist darauf hin, dass in den Redaktionen immer noch mehr Männer als Frauen anzutreffen seien, dass einem dort sehr wenig Diversität und Migrationshintergrund begegne, und reproduziert damit diesen merkwürdigen Reduktionismus, demzufolge Geschlecht, Ethnie, sexuelle Orientierung die Kriterien seien, nach denen sich in den Gehirnen der Menschen die Meinungen bilden. Ein „schwarze“ lesbische Frau sieht die Welt demnach so und so. Auf jeden Fall grundlegend anders als ein „weißer“ Hetero-Mann. Ob sie reiche Eltern hat und einen IQ von 160, spielt keine Rolle, ob sie blind ist oder taub, ob ihre Mutter 300 Kilo gewogen hat und Tourette hatte, ob ihr Vater spielsüchtig war, ob sie als Kind jedes halbe Jahr in eine andere Stadt, ein anderes Land gezogen ist, an welcher Stelle sie in der Geschwisterreihe steht, ob sie viele Freunde hatte, gute Freunde oder gar keine, ob sie ihre prägenden Jahre in einem japanischen Hochhausdschungel oder in der Abgeschiedenheit der Karpaten verbracht hat, alles egal.
Nein, es ist eben nicht egal. Es gibt Faktoren, die die Identität und das Weltgefühl eines Menschen mindestens so sehr prägen wie eine Hautfarbe oder eine Muttersprache. Wenn man Repräsentativität anstrebt, dann müsste man diese Faktoren alle berücksichtigen. Das wird aber nicht machbar sein.
Wie viele verschiedene Migrationshintergründe gibt es in Deutschland? 180 oder so? Die müssten alle vertreten sein, und zwar in jedem Ressort. Wie viele Arten von Behinderungen, wie viele Arten von Sonderbegabungen, wie viele Arten von sozialen Milieus, von Religionen, Lebensweisen welcher Art auch immer gibt es in Deutschland? Die müssten alle vertreten sein, und zwar in jedem Ressort.
Was berechtigt Frau Amann (es sollte mittlerweile klar geworden sein, dass ich mit „Frau Amann“ nicht Frau Amann meine, sondern den Psychotypus des Leitmedienmenschen), was berechtigt sie, anzunehmen, dass beispielsweise ich aufgrund dreier willkürlich herangezogener Kriterien einen bestimmten Normaltypus repräsentiere und mein Freund zum Beispiel aufgrund seines Migrationshintergrunds dermaßen anders und besonders sei, dass er oder seinesgleichen (als ob alle Migranten seinesgleichen wären, nur weil sie ebenfalls ausländische Vorfahren haben!) per Quote irgendwo vertreten sein müssten. Vielleicht bin ich aufgrund von Kriterien, die Frau Amann sich nicht vorzustellen vermag, viel weiter vom „Normaldeutschen“ entfernt als ein Mensch mit syrischen Eltern oder brauner Haut oder einer homoerotischen Veranlagung.
Repräsentativität ist nicht herstellbar. Und auch nicht sinnvoll. Das Gütekriterium eines guten Mediums ist nicht Repräsentativität, sondern kritischer Realismus. Medienmenschen qualifizieren sich für ihre Tätigkeit dadurch, dass sie sich von ihren Prägungen so weit emanzipiert haben, dass sie Kontrolle über ihre biographisch bedingten Einseitigkeiten und Automatismen erlangt haben. Dass sie ihre Subjektivität zurückzustellen vermögen. Wer Medium sein will, muss aufhören, sich vornehmlich als Schwarzer oder Weißer, als Frau oder Mann, als Homo oder Hetero, als Armer oder Reicher, als Ossi oder Wessi zu begreifen. Das ideale Medium hat keine Identität. Der ideale Journalist ist ein rationaler, kritischer, neugieriger, reflektierter, unerschrockener, unbestechlicher Aufklärer. Haarfarbe, Hoseninhalt, Herkunft: egal.
00:39:46
An einer Stelle platzt Precht der Kragen: „Es ist jetzt schon eine Stunde, dass Sie ständig, aber wirklich ständig, mit einer beharrlichen Penetranz Dinge behaupten, die nicht in dem Buch stehen. […] Am Anfang hab ich geglaubt, das ist Absicht. Inzwischen hab ich den Verdacht, Sie haben gar nicht verstanden, worüber wir reden.“
Wahrscheinlich hat er damit recht. Das eigentliche Problem ist aber nicht, dass Frau Amann irgendein Buch nicht versteht. Das große, sozialpsychologisch und demokratiepraktisch verheerende Problem ist, das Amann und ihre Zunftgenossen sich selbst nicht verstehen. Sie verstehen nicht, was sie tun, sie verstehen nicht, inwiefern das ein Problem sein soll, wenn man als Journalist nicht die Welt beschreibt, sondern die eigenen Eindrücke von der Welt. „Herr Precht, Sie müssen doch damit leben, dass ich Sie interpretiere, wie ich Sie wahrnehme“ (00:54:19).
Frau Amann zeigt sich als Fiktivistin par excellence. Sie will partout interpretieren, sie möchte die Dinge so sehen dürfen, wie sie zu ihrem Bild von der Welt, ihrem Eindruck von einem Buch, ihrem Vorurteil von einer Person passen. Und wir müssen damit leben. – Müssen wir eigentlich nicht … umso erstaunlicher, dass wir es immer noch tun.
00:44:43
Aufschlussreich ist auch der Streit darüber, ob Robin Alexander zum politischen Akteur wird, wenn er vom Würstchenstand aus, quasi in Echtzeit, Meldungen aus parallel stattfindenden CDU- und CSU-Fraktionssitzungen veröffentlicht. Soll er, was ihm zugetragen wird, direkt per Twitter raushauen, oder muss er abwarten, sammeln, beobachten und dann einen Bericht verfassen, der am nächsten Morgen in der Zeitung erscheint?
Kann man so oder so sehen, die Beschleunigung im Nachrichtenwesen ist natürlich ein enormes Problem, interessanter ist aber wie immer der Blick darauf, was gar nicht infrage gestellt wird. Das, was nicht infrage gestellt wird, ist immer ein Indikator für das tragende, unbewusste Weltgefühl eines Menschen.
Herr Alexander lebt in einer Welt, in der die wichtigsten Fragen sind: Gibt es Streit in der Union, wer sagt was zu wem, wer droht wem womit, wird die Partei zerbrechen etc.
Frau Amann lebt in einer Welt, in der es von ungeheurer Relevanz ist, wenn Frau Merkel beschließt, den Parteivorsitz abzugeben (00:56:20).
Diese Dinge haben den allerhöchsten Nachrichtenwert, es ist Aufgabe von Topjournalisten wie Amann und Alexander, die Menschen mit diesen Neuigkeiten zu versorgen, von denen sie – Amann und Alexander – glauben, dass sie ihr – der Menschen – Leben in ganz kolossalem Ausmaß betreffen.
Amann und Alexander sind Akteure in einem Spiel, sie sind Teil einer fiktionalen Welt, in der es um „Scoops“ geht, aber nicht darüber nachgedacht werden kann, ob es Parteien überhaupt geben muss, ob es Twitter geben muss, ob es den Würstchenstand geben muss. Die Spielregeln stehen fest und werden nicht infrage gestellt.
Harald Welzer hat mal ein Buch geschrieben, das hieß: „Alles könnte anders sein.“ – Könnte es? Nein, könnte es nicht. Jedenfalls so lange nicht, wie unsere Medien vom Amann-Alexander-Typus dominiert werden. An der Spitze unserer Medien stehen Leute, für die überhaupt nichts anders sein könnte. Es ist für diese Leute, die über die Öffentlichkeit, das Debattenklima, die Diskursordnung, die Massenmentalität, das gesellschaftliche Unbewusste, kurzum: über die Medienrealität entscheiden, undenkbar, dass diese Welt nur deshalb so ist, wie sie ist, weil sie so darüber berichten, wie sie es tun.
01:00:00
„Wir hatten ja den absoluten Super-GAU bei uns in der Redaktion mit Claas Relotius, der Artikel erfunden hat […] unser System hat komplett versagt […].“
Das Problem der Medien ist nicht irgendein Relotius, irgendein Lügenskandal, der alle paar Jahre mal für Aufregung sorgt. Das Problem ist auch nicht irgendeine Schlesinger, die sich auf Kosten des Gebührenzahlers einen schönen Parkettboden gönnt. Mit der Fokussierung auf dergleichen Verfehlungen weicht man bequem auf Nebenschauplätze aus. Man demonstriert Problembewusstsein und gelobt Besserung, um das eigentliche Problem nicht angehen zu müssen.
Jeder Tiefenpsychologe kennt diese Ersatzbezichtigungs- und Selbstbeschwichtigungs-Taktik, der Patient geht dahin, wo es ein bisschen weh tut, sodass er sich glaubhaft einreden kann, er bemühe sich doch, er sei doch sichtlich bereit, den schmerzhaften Weg der Konfrontation zu beschreiten.
Das Logion vom Splitter und vom Balken fällt einem ein (Mt 7,3–5). Immerhin sieht der Patient schon mal einen Splitter im eigenen Auge, nur an den Balken will er noch nicht ran. Aber das Täuschungsmanöver ist im Fall der Medien noch ein Stückchen listiger: Man sieht den Splitter des Bruders Relotius und gibt ihn ganz nobel und selbstkritisch als den eigenen aus. Wir haben versagt. Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Melanie Amann rammt sich den Relotius-Splitter edelmütig ins eigene Auge, um sich von dem baumlangen, tonnenschweren Balken dort drin abzulenken.
Ob Frau Amann jemals darauf kommt, was der Balken in ihrem eigenen Auge sein könnte?
* * *
Kurzer Besinnungs-Appendix: Hab ich mich in diesem Text nicht ausgiebig all dessen bedient, was ich dem Amann-Journalismus vorwerfe? Interpretationen, hypothetische Rückschlüsse, subjektive Eindrücke, Verallgemeinerungen, Unterstellung von Sätzen, die keiner so gesagt hat, null Belege, keinerlei beweiskräftige Zahlen, höchstens Plausibilitäten und wachsweiche Induktionen?
Ja klar, hab ich. Ich darf das aber auch. Warum darf ich das? Weil das hier kein Journalismus ist. Das hier ist Essayismus. Und Essay ist eine Form von Literatur. Das sieht vielleicht manchmal so ähnlich aus, wie das, was Medien machen, ist aber was anderes. Das ist ungefähr so wie mit gemalten Bildern, die aussehen wie Fotos.
Vielleicht ist der Essay die unkünstlerischste Form der Literatur, gehört aber trotzdem zum gesellschaftlichen Funktionssystem Kunst. Hier geht es um schön geformte Sätze und gut gebaute Gedanken. Nicht um Informationen. Hier geht es nicht um wahr oder falsch, aktuell oder von gestern, informativ oder redundant. Das hier ist nicht die vierte Gewalt, hier geht es nicht um die Kontrolle der Regierung. Hier geht es um Anregung, Unterhaltung, Irritation, Genuss, Provokation, Auskotzung, Kritik, Selbstbehauptung, Selbstbefragung, Jammerei, Grübelei, Experimentieren mit Positionen und Perspektiven.
Ich kann hier schreiben, was immer ich will, erfinden, was immer ich will, so was wie Fake News kann es hier gar nicht geben, weil niemand hier Nachrichten erwartet, allerdings immer damit rechnen muss, dass alles auch ironisch gemeint sein könnte, uneigentlich, vorläufig, Bewusstseinsstrom und Rollenprosa; dass auf jede tiefschürfende Einsicht eine Albernheit folgen kann, die alles wortreich Aufgetürmte wieder einreißt.
Der Journalist schreibt über die Welt, der Essayist schreibt immer über sich: ein Ich, in dem die Welt auf eine bestimmte Weise widerhallt. Ein großer Teil der gegenwärtigen Medienmisere rührt daher, dass den Journalisten ihre angestammte Rolle nicht reicht. Sie wollen nicht mehr nur Medien sein, sondern auch Schöpfer. Man hat ihnen eingeredet, sie müssten Geschichten erzählen, die banalen Begebenheiten der Welt als lebendige Stories für ein Publikum aufbereiten. Der Journalist hat aber kein Publikum. Schauspieler haben ein Publikum, Bühnenkünstler, Sänger, Performer, Künstler welcher Art auch immer haben ein Publikum. Medien haben Adressaten oder Rezipienten. Journalisten, die ein Publikum brauchen, die Geschichten erzählen wollen, um Applaus und Ruhm zu ernten, haben ihren Beruf verfehlt.
In ungefähr dem Maße, wie die heutige Bourgeoisie sich in den Lebensformen der Boheme gefällt, hat sich der Journalist ins Künstlertum verirrt. Jemand sollte mal eine Journalistenklinik gründen, wo man den armen Seelen aus ihrer Verirrung heraushilft.
* * *
Interessant war übrigens auch die parallel talkende Runde bei Michael Fleischhacker, in der Norbert Bolz hoffnungsfroh resümierend feststellte, dass dieses ganze unreformierbare Mediensystem irgendwann wohl zwangsläufig ein Ende finden müsse. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Dauer diese ganzen Verrücktheiten: Wokeismus, Political Correctness, Cancel Culture, dass sich das auf Dauer stellen lässt, sondern irgendwann wird das implodieren, und dann kommt vielleicht eine neue skeptische Generation […] Leute, die […] dann tatsächlich auch ein ganz anderes Weltverhältnis und Wirklichkeitsverständnis haben.“ [6]
Diese Hoffnung möchte man wohl teilen. Schön wäre, wenn das System rechtzeitig implodieren täte, also bevor das Pulverfass namens „gespaltene, geschundene, erniedrigte, verhetzte und für dumm verkaufte Gesellschaft“ explodiert.
Wenn Ihnen dieser Text gefällt oder sonstwie lesenswert und diskussionswürdig erscheint, können Sie ihn gern online teilen und verbreiten. Wenn Sie möchten, dass dieser Blog als kostenloses und werbefreies Angebot weiter existiert, dann empfehlen Sie die Seite weiter. Und gönnen Sie sich hin und wieder ein Buch aus dem Hause Flügel und Pranke.
© Marcus J. Ludwig 2022
Alle Rechte vorbehalten