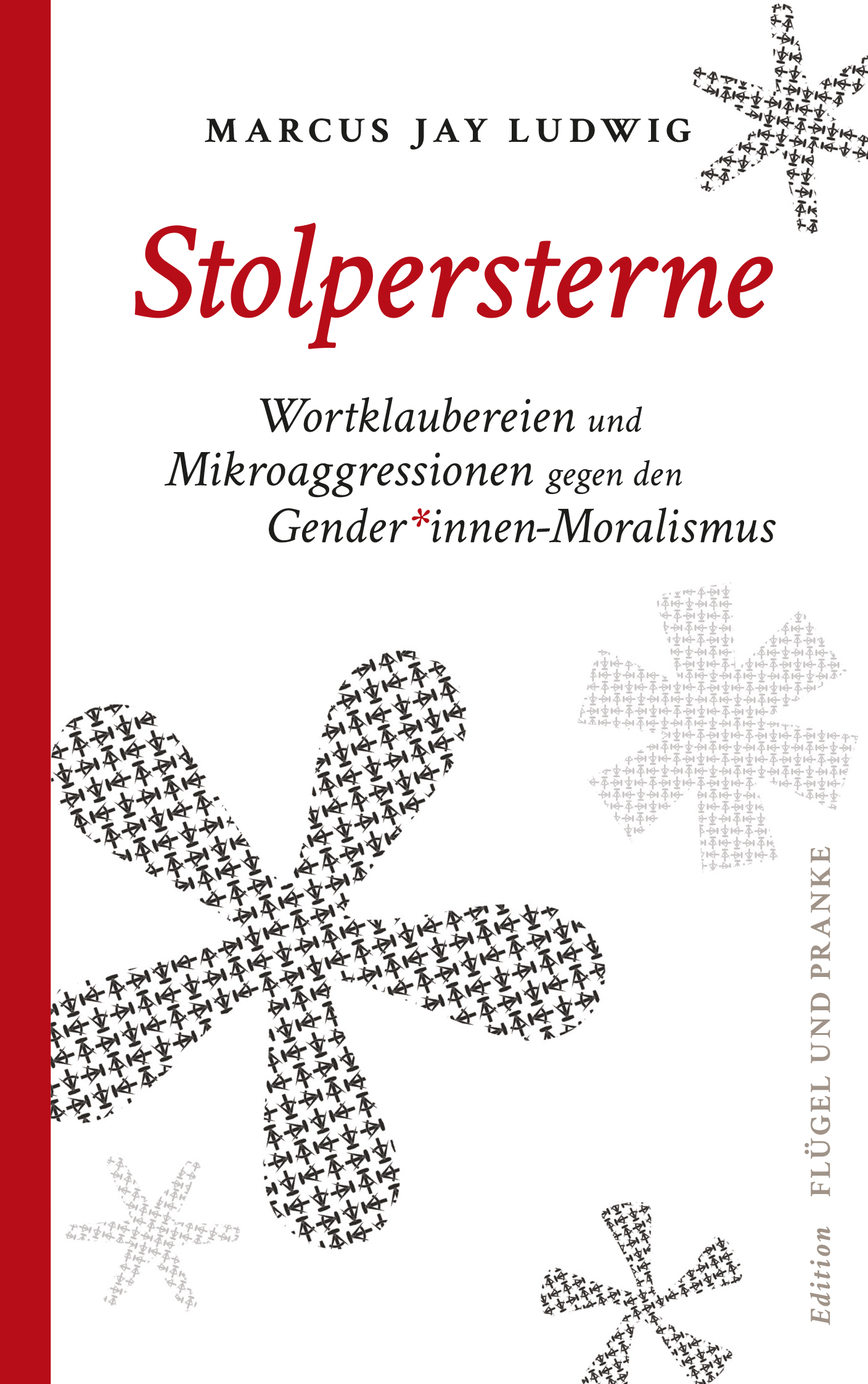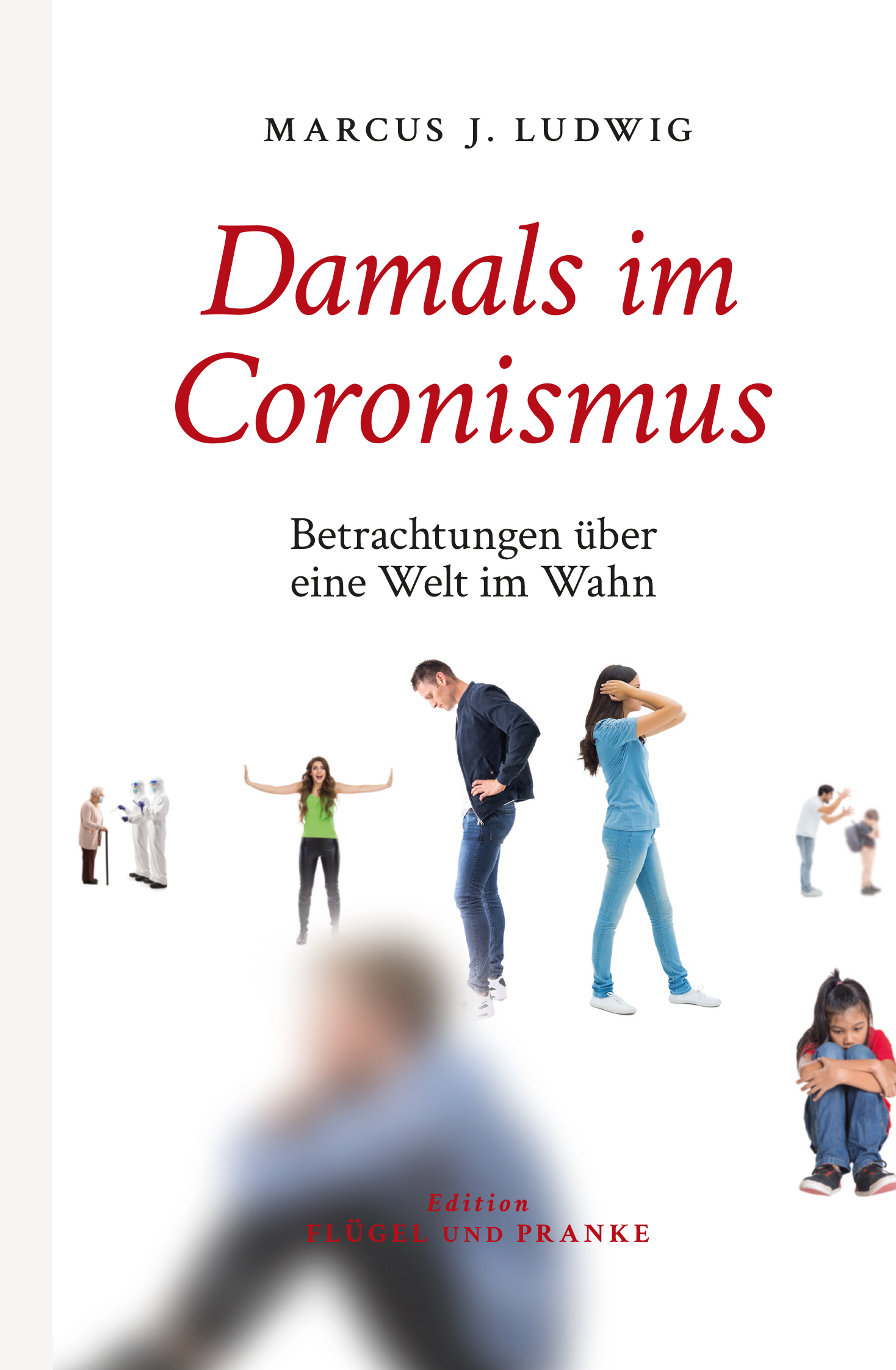Kleine Betrachtung über das Verzeihen und Verdrängen, über kniende Modellierer und die Goldenen Zwanziger nach der Katastrophe
–
Ich bin nicht zynisch genug, vielleicht auch einfach nicht sachlich und cool genug, um von den Worten des Ministers gänzlich ungerührt zu bleiben: „Wir werden einander viel verzeihen müssen“, so sprach Jens Spahn letztes Jahr in der ersten Phase der Corona-Anomalie.
Das mag man so beiläufig als Geschichtsbuchsatz eines menschelnden Politikers abtun, als preiswerte Prophetie, mit der man immer ungefähr recht behält. Aber den Satz ausgesprochen zu haben, zeugt doch immerhin von einer gewissen Antizipationsfähigkeit und einem Bewusstsein für die psychohistorischen Ausmaße dessen, was noch kommen sollte.
Und in der Tat hat sich die Voraussage als ziemlich zutreffend erwiesen. Es wird weiß Gott viel zu verzeihen geben. Einmal mit der Betonung auf viel, also in dem Sinne, dass in dem Jahr seither so unglaublich viel Scheiße passiert ist, dass so viel Schlimmes geschehen und Ungeheuerliches verübt worden ist, das künftiger Beurteilung und Aufarbeitung harrt.
Dann aber natürlich mit der Betonung auf verzeihen, also in dem Sinne, dass wir wohl schlichtweg nicht weiter werden zusammenleben können, wenn wir nicht in einem Akt allergrößter Nachsicht, Versöhnungssehnsucht, Verständigungsbereitschaft zu Worten und Gesten finden, die in schluchzenden Umarmungen enden müssen, und in dem Bekunden, dass wir nie wieder so ungerecht und starrsinnig und lieblos miteinander umgehen wollen.
Bevor wir uns allerdings solch aufwändigem Pathos hingeben, sollten wir vielleicht vorausschauend schon mal klären, wer in diesem Szenario welche Position einzunehmen hätte, wer also wofür um Verzeihung zu bitten hätte und wer Nachsicht zu üben hätte.
* * *
Die Leserbriefe, die mir zugehen, geben vielfach genau das wieder, was ich in meinem persönlichen Umfeld so mitbekomme: Der Corona-Glaubenskrieg geht fiebrig und erbittert durch Familien und langjährige Freundschaften. Im glimpflichsten Fall redet man einfach gar nicht mehr über das ganze Thema, weil man die Folgen ahnt. In eskalationsfreudigeren Beziehungen aber redet und schreit und keift man so lange, bis der Riss durch die Realität grell blutend offenliegt. So sieht es also aus unter der Oberfläche! Die Menschen fassen nicht, dass der andere, seit Kindertagen vertraut und lebenszugehörig, auf einmal sich als so bestürzend anfällig erweist für das doch so offensichtlich Falsche, für die Lügen der Regierung oder die Leugnungen der „Rechten“, die Wahngebilde der Wissenschaftler oder die Verschwörungsmythen der Demonstranten, für die Propaganda der Systemmedien oder die Verharmlosungen der Staats- und Lebensfeinde.
„Wenn du das so siehst!, wenn du das einfach so glaubst!, wenn du das bestreitest!, wenn du da mitmachst!, wenn du daran zweifelst! – dann sind wir fertig miteinander, dann war all unsere Gemeinsamkeit ein großer Irrtum, dann können wir nie wieder auf vertrauter Basis miteinander reden!“ So, etwas verdichtet, enden die Gesprächsdramen zwischen Bruder und Schwester, zwischen herzlich verbundenen Kollegen, zwischen alten Freundinnen, die schon alle Höhen und Tiefen des Lebens miteinander durchgestanden haben.
Wer hatte denn zu Lebzeiten noch mit „großer Zeit“ gerechnet, mit „Ausnahmezuständen“ und „nationalen Tragweiten“? Die Geschichte – jene chronische Sauftour und Gewitternacht, jenes gruppendynamische Stolpern gelangweilter Halbbewusstseine über eine monströse Politkirmes, auf der immer wieder mal alle gewohnten Verhältnisse herumgewirbelt werden müssen – war eigentlich doch zu Ende. Und dann das. Dann kommt so ein Virus und wirbelt einmal alles so richtig durcheinander.
Nein, natürlich wirbelt das Virus überhaupt nicht, es „wütet“ nicht, es „bricht“ auch nicht „aus“. Das Virus macht seelenruhig das, was man halt so macht als seelenloses Virus. Die Wirtsorganismen, die Individuen, die Massen machen den Trubel und den Rummel. – Dass sich allerdings historischer Wirbel und politische Kirmes in sozialem Stillstand und wirtschaftlichem Shutdown manifestieren, ist schon eine Singularität von besonderer Ironie.
* * *
Aber ich sprach von den menschlichen Beziehungen, die dem Virus reihenweise zum Opfer fallen, und Ursache ist eben nicht das Virus, sondern das Reden über das Virus, die Konstruktion grundlegend verschiedener Realitäten um dieses Virus herum.
Die einen sehen eine Bewährungsprobe für generationenübergreifende Solidarität und nationale Menschlichkeit, für Verzichtenkönnen und Durchhaltewillen, für Unterordnung unter die Gebote faktentreuer Wissenschaft. Die andern sehen eine Bewährungsprobe für Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, für Standhaftigkeit gegen die Verlockungen des Totalitarismus, für das Festhalten an den Prinzipien der Vernunft auch unter unsicheren, angsteinflößenden Bedingungen.
Aber, es tut mit leid, mein Bemühen um eine gewisse Symmetrie muss jetzt schon an ein Ende kommen, denn auch bei noch so fairen Vorsätzen ist es ja einfach unübersehbar, dass wir hier keinen ausgewogenen Kampf zwischen zwei Parteien vor uns haben, von denen vielleicht die eine recht hat oder auch die andere. Es ist kein knapper Wettstreit um die zutreffendere Situationsbeschreibung, kein sachlich-gelassener Austausch von Hypothesen unter den altehrwürdigen Spielregeln akademischer Toleranz und dem Wissen um die Vorläufigkeit aller Erkenntnis.
Nein, es herrscht Krieg zwischen den Vielen und den Wenigen, und zwar den vielen „Rechtgläubigen“ und den wenigen Abtrünnigen, zwischen orthodoxen Massen und skeptischen Einzelnen, kritischen Grüppchen. Es stehen sich nicht zwei irgendwie gleichwertige Optionen gegenüber. Es geht nicht um Fragen, die man so oder so beantworten kann. Es geht um den grundlegenden Modus kollektiven Erkenntnisgewinns und gesellschaftlicher Entscheidungsfindung, um das Funktionsgefüge zwischen Wissenschaften und Politik und um die Frage, ob dies nach den Prinzipien des Moralismus oder der Vernunft funktionieren soll. Religion oder Aufklärung? Das ist die Frage – eine Frage, die sich eigentlich nicht stellen dürfte, denn es steht dem vernunftbegabten, mitteleuropäisch gebildeten Menschen seit Kant, seit Popper nicht frei, ob er lieber gläubig und gefügig und folgsam und fromm sein will oder ob er kritisch und rational sein will.
Wer nicht kritisch sein will, wer die Kritik des andern nicht mehr hören will, wer Kritik sogar unterdrücken will, der kündigt den Konsens der abendländischen Moderne auf. Wenn neun Zehntel der Menschen dies sofort tun, sobald nur mal eine etwas unüberschaubare Situation eintritt, dann war alle aufklärerische Schulbildung der letzten Jahrzehnte, all das Sozialkunde- und Geschichtslehrer-Gerede vom mündigen, kritischen Bürger, all das „Wehret-den-Anfängen“-Geblubber offenbar komplett für die Katz.
„Ihr wäret alle gute Nazis geworden.“ Jeder, der nach 1984 eine deutsche Schule besucht hat, musste „Die Welle“ als Buch oder Film über sich ergehen lassen. Ich sehe sie noch vor mir, wie sie betroffen rumsülzen, meine strebsamen jungsozialistischen, junggrünen MitschülerInnen. Vielleicht bin ich ungerecht, aber irgendwie bin ich fast sicher, die sind heute alle, oder mindestens mehrheitlich, stramme Lockdownbefürworter und Wieler-Fans.
Nein, sie wären keine guten Nazis geworden. Aber sie wären jene tragenden, systemerhaltenden Kräfte geworden, die der DDR immerhin 40 Jahre Bestand gesichert haben. Und vielleicht empfänden sie das nicht einmal als Beleidigung.
* * *
Und ich, was bin ich geworden? Die Parzen oder die Gene oder vielleicht auch nur die dornigen biographischen Umstände wollten es, dass ich zu einem prekären Charakter heranwuchs, der allzu oft bereit ist, sich anzuzweifeln, sich anzuklagen, sich für verantwortlich zu halten für Dinge, die er objektiv gesehen überhaupt nicht verschuldet hat. Es sind wohl – neben einer etwas melancholisch-asthenischen Konstitution – die Nachwirkungen einer Kindheit, die geprägt war von Katholizismus und Alkoholismus. Ich könnte eine lange Liste niederschreiben von Schlechtigkeiten, die ich mir regelmäßig vorwerfe. Ich bin in hunderterlei Hinsicht verkorkst und verdorben, aber – und nur deshalb hier dies rührselige Kurzportrait – eines bin ich wirklich nicht: nachtragend.
Ich wundere mich immer über Leute, die jahrelang, jahrzehntelang feindselig bleiben können, einander meiden und dissen und schmähen, als hätte der eine den andern mindestens gekreuzigt und ausgelacht. Kann ich irgendwie nicht. Ich bin zwar immer gern bereit, mich zu streiten oder meine Mitmenschen mit scharfkantigen Ansichten zu provozieren, aber nach der Klopperei sollte dann wieder Friede und Eintracht herrschen, sonst kann ich nicht schlafen. Für Zerwürfnisse und dramatische Feindschaften bin ich nicht zu haben. Im Privaten zumindest. Politisch, geistig, kulturell verhält es sich wohl ein wenig anders. Hier gibt es tödliche Verletzungen, unüberbrückbare Differenzen; die Freund-Feind-Unterscheidung ist unschön, aber durchaus hilfreich, um irgendwie Ordnung in die Welt der Ansichten, Haltungen, Ideale zu bekommen.
Und die Frage ist, ob hier solche Worte wie „Verzeihung“ überhaupt angebracht sind. Es gibt hier folgenreiche Irrtümer, fatale Fehleinschätzungen, desaströse Dummheiten – von geistiger Brandstiftung, Machtmissbrauch, Staatsverbrechen mal ganz zu schweigen.
Wie weit kommen wir hier also mit „Verzeihung“, „kommt nicht wieder vor“, „ach komm, kein Ding“, „kann mal passieren“, „Schwamm drüber“?
Das Nächstliegende, wenn man denn schon probeweise über das Verzeihen nachdenken wollte, wäre wohl, dass überhaupt irgendwer um Verzeihung bäte. Ich habe bislang keinen Minister, keinen Chefredakteur, keinen Modellierer, keinen Denunzianten, keinen Corona-Hetzer und Glaubenskrieger knien sehen. Ich sehe wenig Schuldbewusstsein und Zerknirschung auf Seiten derer, die den einsamen Tod der Alten, die Suizide der Künstler und das verpfuschte Leben der Kinder auf dem Gewissen haben. Ist für die mit dem prophylaktischen Spahn-Wort vielleicht alles im Vorhinein schon abgegolten? Wir werden einander viel zu verzeihen haben – na, dann können wir uns ja jetzt erst mal nach Herzenslust ein paar zünftige Teufeleien antun. So?
Ehrlich, ich wäre fürs Erste schon froh, wenn ich all die armen, abergläubischen Seelen wenigstens verstehen würde; verstehen würde, welche Ängste, welche Dummheiten sie derart verhärten und verbiestern konnten. Ich stehe noch immer vor großen Rätseln, vor Menschen, denen ich einfach nicht zugetraut hätte, dass sie sich mal so vollständig in hysterische Herdentiere verwandeln würden.
Alles verstehen heißt zwar durchaus nicht alles verzeihen, auch wenn eine zum psychoanalytischen Volksgut herabgesunkene Romanweisheit der Frau von Staël das behauptet.
Alles verstehen heißt alles verstehen, und sonst gar nichts. Keine Verwundung, kein Schmerz, kein Rachebedürfnis, kein Wunsch nach Ungeschehen- und Rückgängigmachen verschwindet dadurch, dass man Stück für Stück nachvollzieht und erklärt, wie der Schuldige dazu kam, das zu tun, was er tat, und der zu sein, der er war. Verzeihen ist ein seelisch-emotionales Wundergeschehen, das maßgeblich auf der Resonanz echter, aufrichtiger, körperlich sicht- und spürbarer Reue beruht, auf gemeinsamer Trauer von Täter und Opfer.
Das Verstehen kann aber zumindest auf kognitiver Ebene Dissonanzen auflösen und das Grübeln beruhigen. Das wäre schon mal was.
Wenn ich mir allerdings eben zugutehielt, ich sei nicht nachtragend, dann will ich das nun auch gern beweisen, indem ich hier und jetzt schon ankündige, dass ich keinen Wert legen werde auf irgendwelche flächendeckenden Spruchkammer- und Entcoronisierungsverfahren. Es muss mich niemand persönlich um Verzeihung bitten, ich verzichte sogar aufs Verstehenwollen, ich werde das Mysteriöse dieses ganzen menschlich-allzumenschlichen Corona-Traras einfach hinnehmen. – Nett wäre, wenn der eine oder die andere in ein paar Jahren bei Wein und Lampions auf nächtlicher Terrasse mal murmeln würde: „Vielleicht hab ich damals ein bisschen überreagiert … bin nicht stolz drauf …“
Und dann werde ich sagen: „Jaja, damals … komm, lass stecken … noch n Vino?“
* * *
Äh, Sekunde – das betrifft natürlich nur Freunde und Bekannte und Verwandte – damit wir uns hier recht verstehen. Merkel, ihre Minister, ihre MPs und ihre Modellierer (und nicht zu vergessen ihre mainstreammedialen Abschirmdienste) würde ich schon gern vor einem Untersuchungsausschuss sehen. Und alle andern, die neunzig Prozent folgsam-frommen Volks sollen bitte selbst sehen, an wessen Gartentisch ihnen der Trank des Vergessens gereicht wird. Meine Vorräte sind begrenzt.
* * *
Ein Journalist tat neulich etwas extrem Außergewöhnliches, er pflanzte mir einen Keim der Hoffnung ins Gemüt. Er phantasierte schon für die allernächste Zukunft einen strahlenden Sommer herbei, eine sensationelle Urlaubssaison voller nachgeholter Lebensfreude, voller Aufschwung und nie dagewesener ökonomischer und emotionaler Überkompensation.
Er verwies auf geschichtliche Parallelen, auf die verschwenderischen Feste nach mittelalterlichen Pestepedemien etwa, auf die Roaring Twenties, die Goldenen Zwanziger, das ausschweifend-überbordende Leben nach der Katastrophe des Krieges und der Spanischen Grippe.
Ach, wie gern möchte ich mitgehen bei solch vitalistischen Phantastereien, wie gern sähe ich das Leben am Ende recht behalten und siegen über seine Feinde, über Viren und Wirrköpfe. Aber ist es wirklich vorstellbar, dass die Menschen einfach so, mit einem großen Urlaub, mithilfe südlicher Sonne und Nächten unter Palmen – sei es um Sangria-Eimer sitzend, sei es zwischen Brunello-Flaschen auf der sternenbeglänzten Dachterrasse des Principe di Piemonte zu Italoschlagern tanzend –, dass sie also durch beherztes Umlegen des großen Sommer-Schalters alles einfach so werden vergessen können? Das niedergehaltene, angestaute Leben läuft wieder an, der élan vital bricht sich Bahn, die Daseinsdynamik explodiert, Feuerwerk, großes Orchester, globaler Orgasmus, Jubelfontänen und Paukenknall übertönen die Angst, verjagen die bösen Geister, verdrängen all das aufsummierte Elend?
Möge es so sein. Ich bin – übrigens auch abseits von Corona-Mysterien – durchaus ein Befürworter gezielter Verdrängung. Also, was die „Traumata“ des Alltags angeht, diese kleinen, oft so lächerlichen und doch hartnäckig nagenden Störungen der Seelenruhe. Man kann sich die Nächte um die Ohren schlagen, kann fiebrig durcharbeiten, was man gesagt und gedacht hat, kann analysieren, was der andere gemeint und beabsichtigt hat. Aber man kann das auch sein lassen und stattdessen schon vorher, am helllichten Tage, irgendwas diametral anderes machen, etwas maximal Eindrucksvolles, etwas, das die Aufmerksamkeit total abzieht von der lästigen Peinlichkeit. Etwas, das dem Brüten die Energie entzieht dadurch, dass der Geist in ganz andere Bahnen der Betätigung gezwungen wird.
Fahrradfahren. Klappt bei mir fast immer. Ich habe festgestellt, dass kaum etwas hilfreicher ist zur Traumabewältigung, als einigermaßen sportlich – gerade so sportlich, dass man nicht mehr klar denken kann – durch die Landschaft zu radeln, neue Eindrücke zu suchen, die die vorigen Unannehmlichkeiten „eine Position nach hinten“ schieben.
Das klingt mechanistisch, als seien Hirn und Seele eine Art Speicher oder Regal, das man beliebig bestücken und umdekorieren könnte. Nicht ganz, aber zumindest ein Teil unseres Kopfinhalts ähnelt sehr wohl einer szenischen Ablage, einer Bühne, einem hell ausgeleuchteten Podium, auf dem wir wieder und wieder das betrachten, auf uns wirken lassen, was uns starken Eindruck gemacht hat. Das sind oft eher unschöne, schockierende, destabilisierende Szenen und Erlebnisse: der blutige Unfall, die narzisstische Kränkung, der unnötige Streit, das gequälte Tier, die Hexe aus dem Kinderbuch, die Lüge in den Nachrichten, der prüfende Blick in den Spiegel. Wir können das alles da stehen und wirken lassen und so lange unsere Aufmerksamkeitsscheinwerfer auf die Bühne richten, bis uns das Leben unerträglich wird. Wir können aber auch unsere Kräfte zusammennehmen und das Elend von der Bühne runterschieben, die Gespenster runterscheuchen, uns (zum Beispiel) aufs Rad setzen und ein neues Spiel ansetzen: Eine Fahrt durch Pappelalleen und glühende Rapsfelder, bergab durch Blütenlüfte und wabernde Schatten, Gerüche von Grill und gemähter Wiese, lachende, halbnackte Jugend auf Picknickdecken, die Heckrinder im seichten Flusswasser, kreisende Milane vor hohem Azur, das atmende, pulsierende Körper-Ich als Rausch und Kraft und rollende Sensation im Jetzt der Sommermittagsewigkeit. Man sieht und staunt und applaudiert, und weiß schon nicht mehr so recht, was zuvor auf der Bühne stattgefunden hat … offenbar nichts so wahnsinnig Eindrucksvolles …
Übrigens hängt über der Bühne eine Art Motto, ein Spruchband mit der banalsten und weisesten aller Redensarten: „Die Zeit heilt alle Wunden.“ Sehr richtig. Ich erlaube mir, leise zu ergänzen: Man muss der Zeit aber auch hin und wieder auf die Sprünge helfen, sie etwas anschieben und beschleunigen. Durch Erlebnisse. Dann heilt sie schneller.
Aber gut, ich rede bei all dem von Mikrotraumata, von der mittelmäßigen Blamage, dem unkorrigierbaren bzw. nicht den Aufwand einer Korrektur lohnenden Missverständnis, dem schlichten Ärger über eine erlittene Ungerechtigkeit, die wohl auch so in drei Tagen vergessen gewesen wäre und die halt mithilfe der Verdrängung durch Licht und Luft und berauschenden Weltkontakt nur therapeutisch beschleunigt wird.
Ist aber das Coronajahr ein solch kleinkalibriges Mikrotrauma? Oder nicht doch eher ein Makro-, ein Monster-, ein Menschheitstrauma? Der Erste Weltkrieg und die Spanische Grippe waren zweifellos Megatraumata. Ja, gewiss folgten darauf die Roaring Twenties. Aber war die Sache damit erledigt und bewältigt? Was folgte denn auf die Zwanziger? Die Dreißiger und die Vierziger waren auch ziemlich „roaring“. Für meinen Geschmack ein wenig zu „roaring“. Und direkt „golden“ waren sie eigentlich auch nicht.
Niemand wünscht sich mehr als ich, dass das ganze Corona-Elend mit diesem Sommer einfach zu Ende gehen möge. Abhaken, Schwamm drüber, nie wieder dran denken. Feiern und Vorwärtsleben. Aber ich fürchte, das wird nichts. Ich fürchte, wir müssen den langen Leidensweg der Therapie gehen. Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. Vorwürfe, Tränen, Lügen, Umsichschlagen, Widerstand, Ausflucht. Vielleicht irgendwann Zusammenbruch, Einsicht, Scham, Reue, Regeneration. Ich fürchte, wir werden Höchstleistungen im Verzeihen erbringen müssen.
Wenn Ihnen dieser Text gefällt oder sonstwie lesenswert und diskussionswürdig erscheint, können Sie ihn gern online teilen und verbreiten. Wenn Sie möchten, dass dieser Blog als kostenloses und werbefreies Angebot weiter existiert, dann empfehlen Sie die Seite weiter. Und gönnen Sie sich hin und wieder ein Buch aus dem Hause Flügel und Pranke.
© Marcus J. Ludwig 2021.
Alle Rechte vorbehalten.