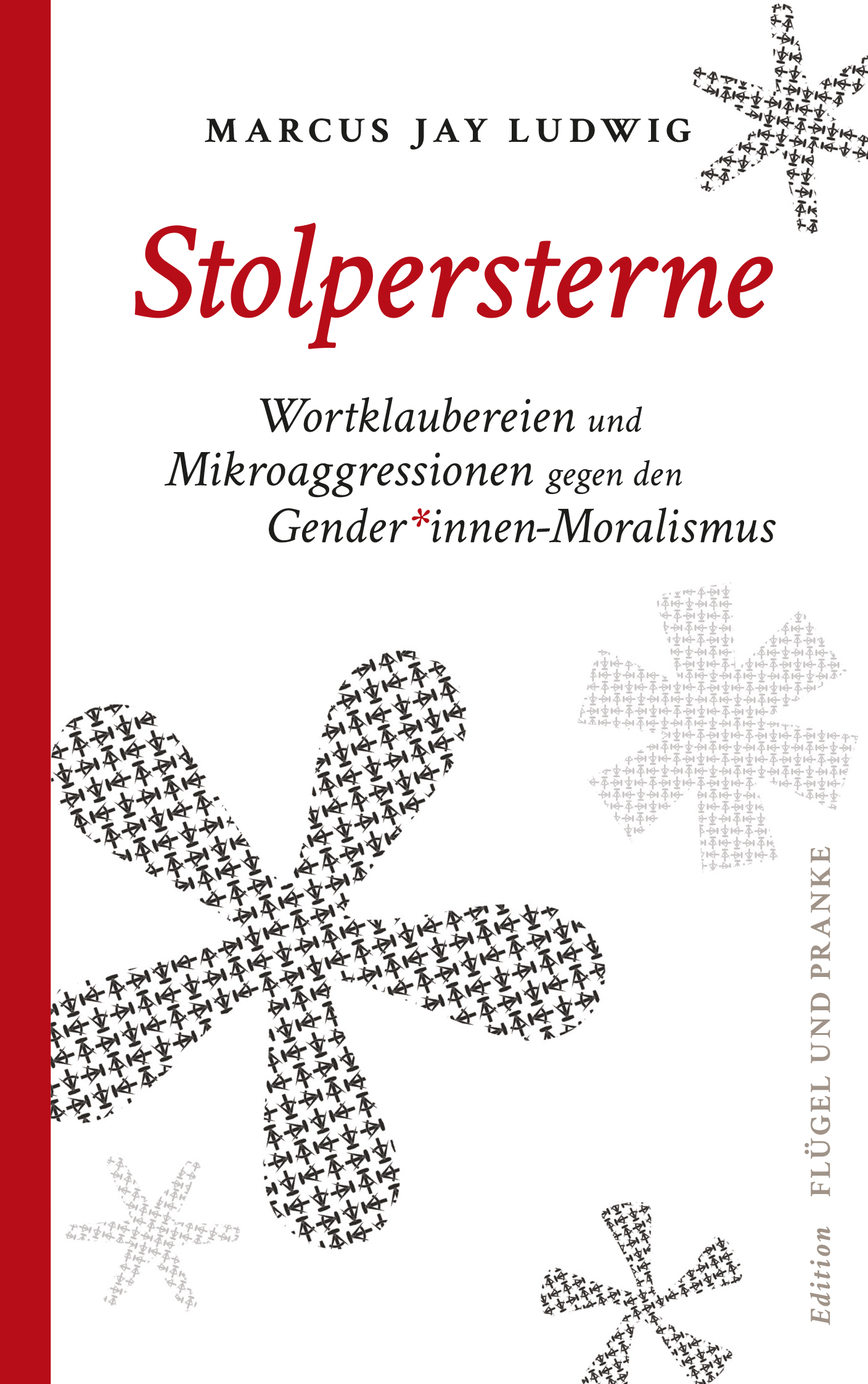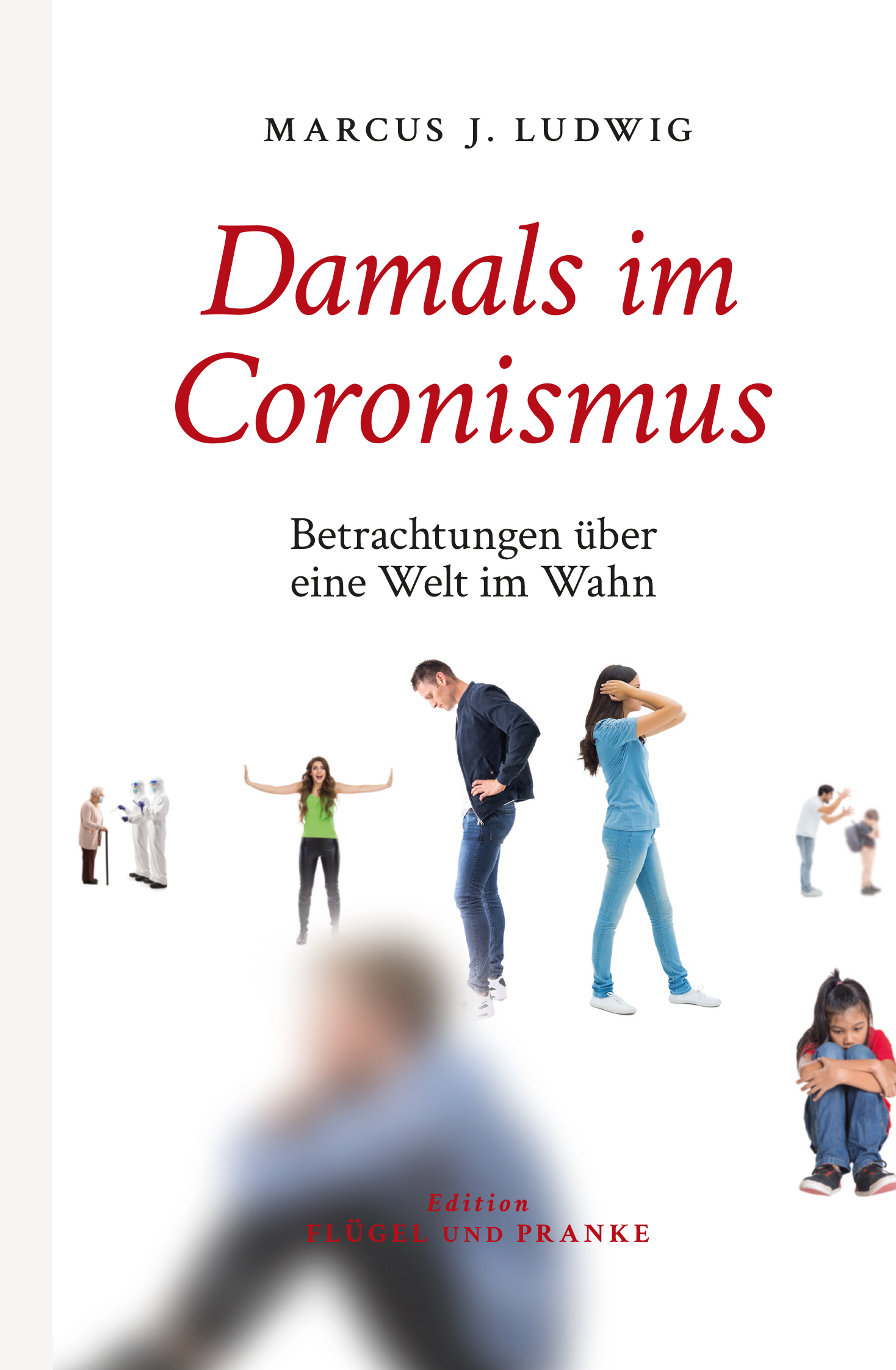Die Scherben des Spiegels – Ein Autor ist etwas anderes als ein Schriftsteller. Das Schreiben, das Verschriftlichen, ist vielleicht das Zufälligste an ihm. Ihm selbst zudem das Lästigste an der ganzen Sache. Die Sache, seine Sache, ist das Wachsein für das Wunder. Das Wunder – das ist die Welt in seinem Innern, und die muss er irgendwie sehen und entwirren lernen, und dann muss er sie aufzeichnen, am besten in Worten, denn das Wort, der Text als schimmernd-vibrierendes Gewebe aus eidetischen und rhythmischen Regungen, hält die ideale Mitte zwischen Bild und Musik. Ob er ein Schönschreiber ist wie Thomas Mann oder ein Stammler wie Heidegger, mag für seine Beliebtheit im Betrieb eine Rolle spielen, ist aber für seine Achtbarkeit unter denen, die sich erkennen über die Jahrhunderte hinweg, ziemlich egal.
Ein Autor ist ein Textproduzent, der es nicht nötig hat, unter seine Buchtitel noch irgendwelche Genrebezeichnungen zu schreiben. Roman, Essay, Betrachtung, Erzählung, etc. – solche Angaben spielen weder für seine Leser noch für ihn selbst eine größere Rolle. Was er veröffentlicht, ist aus sich heraus interessant und lesenswert, es lag ja alles in ihm, er hob es heraus, aus seinen Lebenssedimenten und grübologischen Lustgrotten, er legte es vor, und nun liegt es da und jenseits der Gattungen. Ob man es als Geschichte liest, als Brief und Flugschrift, als Traum oder Tagebuch und Rechenschaft – das ist nachträgliches Sortieren und Bewältigen. Menschenwerk. Der Mensch will immer wissen, was er vor sich hat. Tiere und Pflanzen interessieren sich nicht für Taxonomie. Kunstwerke auch nicht. Künstler erst recht nicht. „The stars are indifferent to astronomy.“ Und der Autor steht den Sternen traditionell näher als den Menschen. Als Mensch mag er ein Menschenfreund sein, als Autor ist er Ur-Heber, das heißt Heraus-Geber des inneren Alls, Heraus-Heber von Pulsaren und seltenen Strahlungen. Etwas in der Art meinte Nietzsche wohl mit dem Logion vom Sterne-Gebären. Und die Alten, die sich als Sprachrohr der Götter fühlten, lagen auch nicht so ganz falsch. Wir würden heute vielleicht nicht mehr von Göttern reden, sondern einfach von Geheimnissen und Emergenzen. Und statt vom Sprachrohr vielleicht eher vom Parabolspiegel. Oder ist das schon Gerede von gestern? Ist der Autor mittlerweile vielleicht nur noch der Geist, der die Scherben des Spiegels zusammenlegt? Der Spuk, der einmal wenigstens sein ganzes Bild in den Blick bekommen muss, um Erlösung zu finden.
Jedenfalls erkennt man einen Autor zumindest daran, dass er zu seinen Büchern keine Vorworte schreibt. Ein Autor schreibt eigentlich eh keine Bücher, er schreibt einfach. Er schreibt auf, was er in sich findet und zutage fördert, und an bestimmten Stellen seines Schürferlebens holt er mal Luft und lässt das bislang Geschürfte, Gehobene und mehr oder weniger Zurechtgeschliffene zwischen zwei Buchdeckel packen und zeigt es den andern: Guckt mal, das hab ich in mir gefunden. Wie findet ihr’s?
*
De profundis – Eine Anfrage der katholischen Hochschule Nolingen, man bittet mich zu einer Gesprächsveranstaltung über Bürgertum, Bürgerlichkeit, Bürgerschaft, meine Idee vom sehenswürdigen Leben etc. Höflich abgelehnt. Ich wüsste nichts zu sagen, was ich nicht in meinen Texten schon besser und gültiger gesagt hätte.
Überhaupt: Ich könnte keinen einzigen Gedanken, keinen einzigen Satz aus all dem, was ich auf tausenden von Seiten verschriftlicht habe, in einem Gespräch reproduzieren und glaubhaft zur Geltung bringen. Dazu müsste ich aus einem Fundus schöpfen, den es nicht gibt. Aus gefestigten Grundlagen und Geistesstrukturen, die nicht vorhanden sind. Es gibt meine Texte, aber soll ich die denn auswendig lernen? Was ich mal geschrieben habe, ist längst vergessen, es war doch alles nur spontane Schöpfung, alles Einfall und Spiel. Wissen solche Leute, die solche Einladungen rausschicken, das denn nicht?
„Why does he never say something profound?“, fragte einmal eine enttäuschte Susan Sontag nach einem Treffen mit Thomas Mann. Die Antwort wäre einfach gewesen: Weil der Künstler seinem ganzen Wesen nach nicht profund ist. Er ist ein Spieler und Augenblickswesen. Kein solide Gebildeter, kein Berufsgelehrter. Er bekommt bloß ab und zu Anfälle von Berufenheit, Andränge und Entäußerungszwänge (er lernt mit der Zeit, diese Anfälle vorsätzlich herbeizuführen), und dann vertieft er sich in seine akute Sache, konzentriert seine schmalen Kräfte – die aber dann vollständig – auf sein zeitweises Ziel, er ist ganz Interesse, ganz Liebesspiel, hellgespannte Meditation und Lichtschockobsession, er steigert sich mit aller Lust hinein in seine Affäre mit dem wildfremden Vorkommnis, und dann kommt mit Glück und Gunst etwas aus ihm herausgeleuchtet, Strahlenwurf und buchstäbliche Exspiration, kommt als Readymade, fertig gefügtes Illuminat und seltsam durchdachte Plötzlichkeit, fremder Einfall und Seelenauswurf, „someone else’s tears in my eyes“. Kein schöner Anblick mitunter, aber immerhin, es kommt etwas. Was es genau taugt, wird sich erst zeigen. Aber, es liegt etwas vor, es ist etwas und nicht nichts. Immerhin nicht nichts. Ein knappes Eins zu Null im Kampf gegen den Horror Vacui.
Und dann ist gut. Jetzt ist Ruhe. Ende, aus, fürs Erste.
Solche Expektorationen können nun zuweilen aussehen wie die Produktion eines Gelehrten, eines Bescheidwissers und gewissenhaft Gedachthabenden. Sind sie aber nicht. Es ist alles artistische Innerlichkeit, herausgespielt aus den Konstellationen des Augenblicks.
Der Künstler ist – im Gegensatz zum Philosophen – nur ein flüchtiger Eintagsepistemiker, er liebt nicht so sehr die Weisheit, sondern vor allem das Spiel, das Als-ob, die Stimmenimitation, den schöpferischen Konjunktiv. Seht: Das alles könnte ich, wenn ich wollte. Das Spiel mit den Möglichkeiten. Nicht selten ein Kampfspiel, das dem Showman alles abverlangt. Und wenn er ausgespielt hat, wenn er sein Resultat dokumentiert und sein Dokument konserviert hat, ist alles auch schnell wieder weg, was geht ihn seine Fantasterei von gestern an, und alles nachträgliche Fragen und Besprechen, alles Inter-Viewen und Vertiefen ist ihm nun höchst peinlich, ist ihm Abfrage und Abiprüfungsalbtraum. Er steht an der Tafel und weiß nichts von all dem, was er irgendwann in Spiellaune aufs Papier geworfen hat. Er stammelt und schweigt, man wundert sich, man hält ihn für einen Hochstapler und Schwindler, und man hat letztlich recht, so zu denken. Es ist ja auch nicht recht, es ist nicht richtig mit ihm. Das ahnt, das weiß jeder echte Künstler, das fürchtet jeder echte Künstler, dass die Welt ihm irgendwann auf die Schliche kommt.
Jeder echte Künstler? – Oder vielleicht eben nur der unechte Künstler? Der halb-echte Künstler? Der Bürger-Künstler? Der ausschweifende Abenteurer im Mittelschichts-Habit? Das Monster in harmloser Menschengestalt?
Thomas Mann hat diesen Produktions-Modus, diese Hochspannungsartistik, die etwas ganz und gar anderes ist als das eigentliche, das echte und respektabel Geistige, im Erwählten ins Bild gesetzt: eben in der Fähigkeit des Helden, sich über alles Menschenmaß zusammenzunehmen, seine Kräfte in einem einzigen Jetzt, in einer alleinexistierenden Aufgabe, einem weltvergessen-werkbesessenen Lebensrechtfertigungskoller maximal und punktgenau zu bündeln. Alles, jetzt, hier.
Der Künstler ist nur in seinen Werken ganz da. Im Leben, im Gespräch mit neugierigen New Yorker Intellektuellen-Gören, auf Podien und Live-Bühnen, wo Tiefgang auf Knopfdruck und gewiefte Akademikerbeglückung gefragt sind, ist er verloren. Wer profunde Weisheiten hören will, muss sich andere Tischgesellschaft suchen.
*
Letzte Abenteurer – „Das ist der Pour-le-Mérite-Jünger?!“, fragte sich ein anderer Intellektueller, ein gewisser Doktor Goebbels, einmal nach einer Unterredung mit Ernst Jünger, dem Kriegshelden und Stahlgewitter-Autor. „Ich bin maßlos enttäuscht“, notierte er in seinem Tagebuch.
Der Künstler als Gegenüber und Gesprächspartner kann nur eine Enttäuschung sein. Kein Mensch kann die Erwartungen erfüllen, die sein Werk, sein perfekt durchgestaltetes Lebensersatzprodukt beim Leser erweckt hat. Man hat sich einem fremden Ich hingegeben, einer glaubhaften Idealerscheinung, einem Krieger, der auszog, den kalten Blick zu lernen, Schlachtenbummler und Registrator, Schöngeist und Springinsfeld, man erlebt mit ihm und durch ihn das „Weltfest des Todes“, die Überwältigungen der Materialschlachten, die Bluträusche und Überlebensorgien an den Grenzen des Menschenmöglichen, man wird vierzehnmal verwundet, Kopfschuss, Beinschuss, Bauchschuss, Lungenschuss, Granatsplitter, Schrapnellkugeln, Fieber, Nahtod, man verlässt den Körper als Seele, kehrt als gehärteter Geist zurück an die Front, ins Niemandsland, zur Ehre der Nation, zur eigenen Bewährung und Belustigung, watet weiter durch winterkalte Schlammgräben und fäulnisbuntes Leichenallerlei, sieht und hört und riecht die Auslöschung einer Generation unter Gaswolken und Feuervorhängen … und dann, ein paar Jahre später, sitzt man – Leser und Autor, einst vereint im erzählenden Ich – in bequemen Fauteuils einander gegenüber bei Cognac und Zigarren, und der Held, vom Leutnant zum Literaten gewandelt, ein Männlein mit offenem Jungengesicht, konturiert, aber alles andere als schneidig, ein drahtiger Träumer, ein vielfach Entlaufener und Eichendorff-Taugenichts, Traumwandler, Bohemien, Revolutionär, Blumensammler und Bücherwurm, mit einem Wort: ein Romantiker, er redet umständlich steile Seltsamkeiten vor sich hin, und hat mit dem Superhelden aus dem Lektüreerlebnis nichts zu tun. Man hat sich täuschen lassen, nicht vom Autor, sondern von den eigenen Projektionen, und ist nun – zu Recht? zu Unrecht? – enttäuscht.
So ist das. Man kennt das. Mancher kennt es von beiden Seiten.
Ernst Jünger … rätselhaftes Phänomen, Fabelwesen, schwer unterzubringen in der Taxonomie der Besonderen … der Künstler als Krieger. Oder umgekehrt? Die gemeinsame Basis, die Grundhaltung des Ichs zur Welt ist wohl einfach: Abenteurertum. Aber der gesunde Künstler – im Gegensatz zu Thomas Manns Lebensschwächlingen und Neurasthenikern – ist echter und tätlicher Abenteurer. Er bricht auf zu den wirklichen Kämpfen und Bewährungen, es zieht ihn hinaus in Schlachten und Survival-Wunder, statt in die schwülen Dschungel der Innerlichkeit und Empfindsamkeit.
„Man ist als Künstler innerlich immer Abenteurer genug“, meint Tonio Kröger. „Äußerlich soll man sich gut anziehen, zum Teufel, und sich benehmen wie ein anständiger Mensch.“
Das kann Ernst Jünger, der kein zu verheimlichendes Sexualproblem mit sich durchs Leben schleppen musste, natürlich völlig anders sehen. Er kann „befreit aufspielen“, wie man so im Sportreporterjargon sagt. Und genau so ist es, genau so mutet es uns an, dieses Lebensspektakel über ein ganzes Jahrhundert: wie ein befreites Aufspielen. Ein Flaneur, der sich tausend Fehltritte leisten kann und einfach nicht totzukriegen ist, der sich durch keinen Blutverlust, keine feindliche Übermacht, keine eigene Verirrung beeindrucken lässt, er flaniert durch die Jahrzehnte, leicht gerüstet in schimmernder Desinvoltura, und wird wie von selbst zum führenden Faszinosum all derer, die sich die alten Fragen stellen nach den Möglichkeiten des Ineinanders von Kunst und Leben, Schmerz und Einsamkeit, Welthunger, Menschenhunger und mönchischem Aristokratismus. – Interessant aber, dass in der Rückschau dann doch beide, Jünger und Mann, scheinbare Antipoden, völlig problemlos in der Endphase der bürgerlichen Kultur nebeneinander, als Varianten desselben Typus, unterzubringen sind. Gute alte Zeit, echte Zeit immerhin, mit echten Menschen und echten Problemen. Welten und Epochen entfernt von uns, die wir weder abenteuernde Bürger noch bürgerliche Abenteurer mehr sein können. Weder Sanatoriumshospitanten noch Stoßtruppführer, weder Sorgenkinder des Lebens noch landsknechtische Draufgänger. Wir sind der Neue Mensch, das letzte Gezücht. Verhausschweinte, sabbernde Hybris und synthetisch grinsende Fehlkreuzung. Monitorisierter Menschenkehricht und dauersedierter Pöbel. Grunzende Endzeit vor dem großen traumlosen Schlaf. Denn es ekelt die Evolution und es reut die Mutter der eigene Sohn, und sie sehnt ihn entgegen dem finalen Fieber, dem letzten Eiterbrand, der jubelnden Sepsis, die dem Unwesen ein Ende bereitet.
Ach, wär ich hundert Jahre früher geboren. Was hab ich in dieser widerwärtigen Scheißepoche verloren?
*
Art und Familie – War sie denn wirklich so widerwärtig? Ähnelte meine Zeit nicht anfänglich sehr dem Paradiese? Mochte mein kleines Einzelschicksal sich zeitweise auch recht höllisch anfühlen – als Ganzes hatte sich die Welt auf einem Optimum zurechtgeruckelt. Wie klar liegt das zutage im alternden Licht des Rückblicks. 1975, 1985, 1990, ein versunkenes Märchenreich, ein erloschenes, aber wirklich gewesenes Idyll. Es gab Missstände und Elend – Kriege, Krisen, Katastrophen zuhauf –, aber das Wesentliche war gewahrt, die Maße des Menschlichen, die Proportionen stimmten. Die Beschränkungen. Dem Ich und dem Wir war ein Kreis gezogen, in dem artgerechtes Leben möglich war. Die tausend Probleme der Menschheit waren Oberflächenphänomene, Hautkrankheiten gewissermaßen, oder temporäre Infekte. Heute aber haben wir die Krankheit zum Tode, maligne Wucherungen, die uns aus dem Innersten heraus zerfressen, heute haben wir das Internet.
Es ist bezeichnend, dass niemand zu sehen scheint, wie sehr diese unaufhörlich wachsende Weltwahrnehmungsstruktur dem gleicht, was im fleischlichen Kontext Krebs heißt. „Raumforderung“ nennt der medizinische Phänomenologe so was. Der Kulturarzt sieht das gleiche Geschehen im Cyberspace. Es sieht aus wie Bewusstseinserweiterung und gemeinnützige Synergie, ist aber informationelle Karzinose. Das Internet ist maschinell erzeugter mentaler Turbokrebs.
Der menschliche Geist ist ein biopsychischer Emergenzgenerator, ein zartes energetisches Gewebe von vitruvianischen Proportionen, ein über Ewigkeiten evolviertes Lichtspiel und Nervengeflecht, an dem nun seit knapp dreißig Jahren – phylogenetischen Sekündchen – ein perniziöses Psychom, eine Seelengeschwulst von mittlerweile Planetengröße herangewachsen ist. Eine Öffentlichkeit, eine Gleichzeitigkeit, die alles Humane überwuchert, ein Gesellschafts- und Weltgefühl, für das dieses Wesen, das als besseres Tier gedacht war, nicht gemacht ist. Der Mensch kann mit der Ewigkeit umgehen, mit der Unendlichkeit des Alls. Er kann mit Himmeln und Höllen hantieren, kann unter Göttern und Dämonen leben. Aber er kann nicht mit acht Milliarden von seinesgleichen leben und in Beziehung treten. Es ist etwas anderes, ob man in einem Westerwälder Dorf von dreihundert Einwohnern lebt und vage weiß, dass es da draußen irgendwo noch Milliarden von anderen Menschen gibt, oder ob man mit all diesen Menschen jederzeit in Beziehung steht, indem man dieselben Bilder, dieselben Stories, dieselben Aufreger, dieselben künstlich erzeugten Gefühle teilt.
Der Mensch, der anthropometrisch wohlbehaltene Mensch, sehnt sich nach der Geborgenheit einer sozialen Umwelt von ein paar Allernächsten und ein paar mehr Nächsten. Nach einer Familie und einem Dorf. Er braucht den engen Kreis von vielleicht zwölf, zwanzig Verwandten und Freunden und den weiteren Kreis von vielleicht hundert, hundertfünfzig Bekannten, Nachbarn, Kollegen. Und er braucht das soziale Jenseits, die Fremde, die weite Welt da draußen. Er braucht keinen Globus von acht Milliarden Artgenossen, die ihm plötzlich als Nächste aufgedrängt werden. Die Art ist nicht die Familie.
Wer „Menschheit“ und „Weltgemeinschaft“ sagt, will nicht unbedingt betrügen, er will vielleicht nicht einmal lügen. Aber er lügt. Er belügt sich und uns, uns alte Menschentiere, über die mentalen Möglichkeiten des Menschen. Wir wissen noch, wie es war, damals in der echten Welt, bevor die Entzauberungsmaschinen den Geist übernahmen und uns vom Leben entfremdeten.
Nein, es war vielleicht doch keine Scheißepoche, in die ich da hineingeboren wurde. Vielleicht muss ich dankbar sein und wehmütig wie Stefan Zweig, dass ich noch ein besseres Gestern erleben durfte, ein Vierteljahrhundert immerhin von einer Welt, für die es sich zu kämpfen gelohnt hätte. Wenn man gewusst hätte, wie bedroht sie war.
*
Tristanakkord – Zauber entsteht durch das richtige Verhältnis von Unverständnis und Ahnung. Zauberhaft ist das maßvoll Fremde und Nichtintegrierbare. Wie die Kinder, die ins Leben erwachen, verstehen wir noch nicht, was da passiert in der Welt der Großen, aber wir spüren, dass es da etwas zu verstehen gäbe. Wir bleiben in unserer heimlichen Begrenztheit und ahnen doch schon das Ungeheure in den Sphären, die wir vorerst nur von unten sehen. Der ist der größte Zauberer, der uns dieses konjunktivische Kindergefühl zurückzuhalluzinieren vermag. Diese milde Gewalt der Überforderung, dieses gespannte Staunen, das mit feierlich heißen Backen im Zentrum einer noch unentdeckten Weihnachtswelt sitzt und nicht zwischen Christbaumkugeln und Planetensystemen unterscheiden muss. Diese unmündige Ohnmacht, die sich alles Magische erlauben kann.
Es ist ein Irrtum der konsumverhunzten Gefühlsgrobiane unserer Zeit, zu glauben, sie bekämen ihre paradiesischen Kindergefühle zurück, indem sie ihre alten Kinderbücher läsen und ihre Kinderfilme nach Jahrzehnten wieder anguckten. Oder sich als Erwachsene mit vorsätzlicher Regressionslust noch in die Harry-Potter-Welt stürzten. Der Zauber kommt so nicht zurück. Keine Chance. Denn die Magie liegt nicht im Inhalt, nicht in irgendwelchen konstruierten Stories von Kindern, die phantastische Abenteuer erleben. Den Zauber bringt allein die Sprache zurück, die Musik, die fremde Macht des ahnungsvoll Unverständlichen. Inhalte sind weitgehend austauschbar. Alles hängt am richtigen Maß der Überforderung durch das Geheimnis. An der Weite des verheißungsvoll-beängstigenden Möglichkeitsraums, an der Reichweite des Scheins, den das Wort, der Klang, der Traum in die Dunkelheit wirft. Mit einem Wort: am Tristanakkord.
*
Bestien – Ich will euch nicht hassen, aber ihr lasst mir keine Wahl. Ihr macht diese schöne Welt kaputt, jeden Tag noch ein Stück kaputter, dieses alte Europa, diese ehedem so menschengemäße Halbinsel der Liberalität, der (immerhin rudimentären) Rationalität und Humanität, der befriedeten Bürgerlichkeit, des staatlichen Gewaltmonopols, des Rechts und der Alltagssicherheit, der produktiven Lebensungezwungenheit … alles macht ihr kaputt für euer geisteskrankes, moralistisch-perverses, ideologisch verblendetes Transformationsprojekt. Ihr wollt das Land, den Kontinent, die Welt „trans-formieren“, „hinüber-gestalten“, und ihr werdet es schaffen, no doubt, bald schon wird hier alles „hinüber“ sein: jenseits, tot, entseelt, zugrunde gerichtet, im Arsch, am Ende.
Ein Video, ein älterer Mann, der von jugendlichen Migranten angepöbelt und geschlagen wird. Nichts Neues, Alltag in Mitteleuropa. Ich kriege mit, wie wieder mal der Hass sich entzündet an solchen Szenen der Schande, wie dem Twittervolk das Blut in den Adern kocht, ich ahne, wie hier nur noch irgendein Charismatiker in der Wut wühlen und nachstacheln muss, damit der Mob sich zu echten Ausschreitungen zusammenfindet. Und ich hätte fast Verständnis dafür – nein, nicht ich, das Böse, Primitive, das Archaisch-Atavistische in mir, das Kindisch-Rachsüchtige in mir, und das habt ihr aktiviert. Ihr lockt sie immer weiter heraus, die Bestie, die ich zu bezähmen versucht habe mein Leben lang, seit damals, seit ich selber schlimmes Kind war und Bestie, die ausschritt zum Nichtwiedergutzumachenden. Dafür hasse ich euch von Herzen, dass ihr mich dahin zurückpeitscht.
Eigentlich macht mich dieses Video nur unendlich traurig. Ich sollte es vielleicht in Worten festhalten, in Zeitlupe, Sekunde für Sekunde meine Gefühle dazu protokollieren, aber ich kann es mir nicht nochmal ansehen. Kinder sieht man da, dreizehn, vierzehn, asoziale Asylantenkinder, halbstarker Abschaum, ein schwarzer Junge ohrfeigt einen tapsigen Mann, einen Rentner oder so, der ein bisschen merkwürdig wirkt, so leicht parkinsonartig oder vielleicht ein wenig retardiert, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach kataplektisch, starr vor Angst. Sein Hündchen, ein zierliches Nervenbündel, versteht die Welt nicht mehr, sieht immer wieder aufgeregt zu ihm hoch … ich sehe die Szene aus der Perspektive dieses Pinschers oder Whippets oder was das ist. Mach doch was!, bellt er, wehr dich oder ruf um Hilfe oder renn, aber lass dich nicht von denen schänden und dabei filmen. Am Ende stoßen diese Arschgeburten den unbeholfenen Mann zu Boden, er fällt über seinen Hund – ich muss das stoppen, ich kann nicht noch zusehen, wie das Tierchen unter ihm zerquetscht und zerbrochen wird. Ich bin kurz vorm Kotzen.
Ich will nichts mehr sehen davon, ich will auch nicht wissen, wie das alles ausgegangen ist … kam die Polizei, kommen die kleinen Satanoiden vor Gericht, in den Knast, gibt es Gerechtigkeit? Für das Opfer gibt es keine Gerechtigkeit, was soll der Typ denn jetzt machen, wie soll der weiterleben, der kann sich doch nur noch umbringen, oder? Wie wird der je wieder raus auf die Straße gehen können … von kreischenden Raubtierkids in den Dreck getreten, nichts wird je wieder gut, und ich kann nicht aufhören, an den Hund zu denken, die verängstigte Kreatur, das soziale Tier, das nicht fassen kann, wie sein Herrchen fällt. Das alte dicke Europa liegt wehrlos am Boden. – Scheiße, wenn dieser Kerl sich nicht umbringt, muss ich mich für ihn umbringen, vor Scham und ohnmächtiger Wut.
Und wisst ihr, wer diesen armen Mann und mich und das zertrümmerte Hündchen auf dem Gewissen hat? Ihr, ihr moralistisch-ethnomasochistisch versifften „Gutmenschen“, ihr politmedialen Europahasser aller Couleur, ihr antiweißen Rassisten, ihr habt diese johlenden Jungkrieger, dieses sadistische Barbarengezücht reingelassen ins Abendland, ihr habt es aus den Slums und den Halbwüsten, aus den Wellblechhütten und den heiligen Kriegen hergelockt und euch gefreut auf die „Veränderung“, die es mitbringt, und auf die „Drastik“, ihr habt euch gefreut auf den Anblick dieses taumelnden dicklichen alten Europäersacks, der ordentlich was vor den Latz kriegt und endlich zu Fall gebracht wird zur Strafe für seine rassistische, sexistische, kapitalistische, kolonialistische, nationalistische, rechtsextremistische Scheißexistenz, nicht wahr?
Ihr wolltet es so, ihr wollt es immer noch und weiterhin so, sonst würdet ihr es ja stoppen und umkehren, aber die Bilder schrecken euch nicht, die Bilder stören euch nicht, die Bilder berühren euch nicht.
So schlafe ich ein, so würge ich mich in den Schlaf. Und als ich erwache, finde ich mich in einem Waffengeschäft wieder, meine Träume sind direkt übergangen in Gedankenspiele und Pläne. Ich überlege zum ersten Mal, zum ersten Mal jedenfalls mit echtem Vorsatz, welche Waffe ich mir zulegen soll, damit ich mich einigermaßen wehren kann, wenn es so weit ist. Es wird so weit sein, irgendwann. Irgendwann werde ich dran sein. Auch in meiner Hood laufen Typen rum, von denen man ahnen darf, dass es nur eines etwas zu langen, etwas zu direkten Blickes bedarf, um ein spontanes Gepöbel, Gerangel, Geschlitze auszulösen. Wenn mir solche Typen begegnen, meist sind es zwei oder drei, schlage ich den Mittelweg zwischen Deeskalation und Behauptung ein. Ich will nicht provozieren, aber ich will auch nicht ausweichen, zu Boden blicken, mich wegducken, den Invasoren das Terrain überlassen. Ich geh mit dem neutralsten, unbeteiligtsten Blick, der mir möglich ist, an den orientalischen Ehrenmännern vorbei wie an einem Kampfhunderudel, versuche mein Adrenalin und meine Pupillen zu kontrollieren, versuche keinerlei Signal zu senden, das mich zur Beute oder zum Rivalen machen könnte. Ich versuche, in meiner Parallelwelt zu bleiben.
Ihr seid schuld daran. Ihr seid schuld an meinen Adrenalinstößen, an den Gedanken, die ich mir machen muss über meinen Gesichtsausdruck, meine chemische Kommunikation. Ich habe keine Lust, neutral zu gucken, ich hab keine Lust, Mittelwege einzuschlagen, ich hab keine Lust, in einem Land zu leben, in dem ich ständig deeskalieren muss. Ihr zwingt mich dazu, ihr habt diese Raubtiere ausgesetzt in meinem Lebensraum.
Es läuft wohl auf einen Schlagstock hinaus, so ein Teleskopteil. Ich recherchiere die rechtliche Lage. Sie ist etwas unklar, die Dinger sind frei verkäuflich, aber man darf sie nicht in der Öffentlichkeit mit sich führen. Oder irgendwie doch … je nachdem, ob der Richter das als „Stahlrute“ einstuft, dann ist es ein „Totschläger“, oder als starren Stock, dann gibt’s nur ein Ordnungsgeld, oder so.
Aber warum sollte man so ein Teil überhaupt bei mir finden, wenn ich das in der Jackentasche stecken hab. Ich bin in meinem Leben noch nie einfach so von der Polizei durchsucht worden. Und auf den Wegen, die ich am Tage so zurücklege, hab ich ohnehin seit etwa 35 Jahren keine Polizei mehr gesehen. Früher gab es einen Stadtteilsheriff, den sah man jeden Tag irgendwo rumspazieren. Den würden die kleinen Prädatoren heute genauso lustvoll und umstandslos umnieten wie diesen tapsigen Hunde-Rentner.
Ich schaue mir ein Video an, wo ein gutgelaunter Waffenfreak diverse Stöcke testet, Testobjekt ist eine Kokosnuss. Ein gezielter Schlag und das Ding ist nur noch ein Häufchen Raspeln. Der Anblick schreckt mich ein wenig ab. Wenn ich mich gegen irgendeinen Angreifer wehren muss, will ich dem ja nicht direkt seinen hirnlosen Schädel in Scherben hämmern. Oder doch? Es fällt mir nicht allzu schwer, mir vorzustellen, wie ich diese drei Typen, die mich und meine Frau umringen und anschreien und anspucken und anfassen und rumschubsen, es fällt mir nicht schwer, mir vorzustellen, wie ich diesen Wichsern kalt entgegenlächele: „Ihr dreckigen kleinen Dreckswichser habt euch den Falschen ausgesucht.“ Und – zack – fahre ich den Teleskopknüppel aus. „Ihr habt jetzt exakt drei Sekunden, um abzuhauen, und euch dann hier nie wieder sehen zu lassen. Eins … zwei …“
Aber die Typen hauen nicht ab, die wollen‘s echt wissen. Mir dämmert, ich werde wohl wirklich Gebrauch machen müssen von dem Coconut-Crusher.
Ich bin nicht gerade zur Handgreiflichkeit geboren, aber ich weiß, dass ich ausrasten kann, und dann zwar nicht zu allem, aber zu einigem fähig bin. Das macht mir zuweilen Angst, ich möchte eigentlich keiner sein, der ausrastet, aber ihr zwingt mich dazu, mir das vorzustellen und es als Möglichkeit in mein Leben einzubauen. Ihr zwingt mich, darüber nachzudenken, ob ich jemandem den Kopf zertrümmern könnte, ob ich mit voller Wucht zuschlagen könnte mit einem Kilo Stahl auf einen schwarzgelockten Schädel. Ja, schwarzgelockt ist der Schädel, den ich sehe, ein afrikanischer oder orientalischer Knabenkopf beim Zerplatzen, ihr zwingt mich, mir das genau so vorzustellen, ihr zwingt mich, dass ich mich verachte für diese Vorstellung, aber es ist nun mal jene Vorstellung, die in den täglichen Verrohungs-Videos zur Darstellung kommt: Irgendwelche Teenager aus Afrika, junge Männer aus dem nahen und mittleren Osten prügeln oder stechen auf mitteleuropäische Menschen ein, und ich muss mir nun vorstellen, welches Maß an Brutalität, an Überlebenswillen ich in meinen Schlagarm zu leiten imstande wäre, und was dieser Schlag dann mit dem Fleisch, der Haut, den Knochen, den Adern, den Zähnen irgendeines sittlich verwahrlosten Migrantenburschen machen würde. Schlage ich mit voller Wucht zu, würde ich ihn womöglich töten. Schlage ich zu sachte zu, wird er zurückschlagen, werden seine Kollegen mir den Stock entwinden und erst recht auf mich einprügeln, und wenn ich schon zahnlos und zerschmettert auf dem Asphalt liege, sehe ich noch durch die Scherben meiner Brille, wie sie meine Frau in Stücke reißen, blutbegeisterte Lykaonen, dionysische Bestien; ich sehe, wie unsere Pulse verebben, unsere Leben enden und rot zusammenrinnen; wie ihr letzter ungläubiger Blick abbricht vor meiner verröchelnden Seele, wie wir da liegen bleiben, bis man uns findet: zwei Einzelfälle, die nichts zu tun haben mit irgendetwas. Nichts, was ihr entschieden habt, nichts, was ihr herbeigerufen hättet, nichts, was euch von eurem Wahnsinn kurieren könnte.
Scheiße, ich hasse euch für meine Fantasien.
*
Weber und Richter – Meine an diese Aufzeichnung sich anschließenden Folgefantasien beschäftigen sich mit den Schrecknissen von Gerichtsverhandlungen und Gefängnisaufenthalten und also auch mit der Frage, ob ich so ein Imaginat vielleicht irgendwie erklären, rechtfertigen oder sogar in vorauseilender Selbstzensur entschärfen sollte.
Gilt dergleichen heute als Volksverhetzung und Hassrede? Sind das Worte, aus denen Taten folgen? Bin ich verantwortlich dafür, dass labile Leser sich Schlagstöcke kaufen, sie illegal mit sich führen und zum Einsatz bringen?
Klar, wer den Text sine ira et studio liest, wird leicht feststellen, dass da kein politischer Agitator spricht, sondern ein Ich, das Angst bekommt vor sich selbst, eine reflexive Erzählinstanz, ein ratloser Protokollant, der sich befragt und beklagt. Indem er jene anklagt, die ihn in etwas verwandeln, das er nicht sein will.
Aber die Ankläger von heute lesen eben nicht sine ira et studio, sie lesen mit dem unbedingten Willen zum moralistischen Missverstehen, sie haben eine historische Mission, die sie berechtigt zu jedem Vernichtungsfuror.
Natürlich ist das kein ausgewogener Text. In so einem Stück geht es nicht darum, einer ganzen Sachlage gerecht zu werden, etwa zu zeigen, dass es auch friedliebende, freundliche, hochintelligente, bestens integrierte und sogar weibliche Migranten gibt. Ein halbfiktionaler Text darf sich auch der halben Ironie bedienen, die das Erzählen meines (und Thomas Manns) Erachtens grundieren sollte: Wer spricht, hat recht.
Heißt das, ich habe recht? Nein, es heißt, „ich“ habe recht. Es spricht hier ein fiktionalisiertes Ich, das mit der echten Person, dem Autor, Überschneidungen aufweist, aber nicht identisch ist mit ihm. In echt würde ich z.B. einen Teufel tun und mit einem Kilo Stahl in der Jacke rumlaufen … bin ich denn bescheuert?
Das Text-„Ich“ spricht seine subjektive Sicht aus, es muss nicht das ganze Bild geben, alle Seiten zu Wort kommen lassen, Gerechtigkeit walten lassen. Der ÖRR muss das (und tut es nicht), „ich“ muss es nicht. Und ich (ohne Vorbehaltszeichen) auch nicht. Ich bin kein Informationsmedium, ich bin nicht mal ein Meinungs- und Kommentarmedium, ich bin nur ein Musiker, der klangvolle und intensive Texte produzieren will. Die meisten meiner Texte sind eigentlich verhinderte Songtexte, die nur deshalb so lang sind, weil ich die fehlende Musik in Worten nachbilden muss, einen Sound aufbauen muss, in dem bestimmte Aussagen und Wortschöpfungen überhaupt erst möglich werden. Man wird an einen Songtext wohl nicht die Forderung stellen, dass er ausgewogen, objektiv und gemäßigt zu sein habe.
Ich erinnere mich an ein Interview, das Katrin Bauerfeind vor Jahren mit Jochen Distelmeyer von Blumfeld führte. Sie fragte, warum er neuerdings in seinen Liedern solche gefühligen, kitschig direkten Innerlichkeiten von sich gebe, immerzu Liebe, Herzschmerz, Vertrauen, Tränen, Zärtlichkeit, die ganze sentimentale Schlager-Palette. Er antwortete: „Weil es das gibt.“
So einfach ist das. Und leider gibt es eben auch Hass und Hoffnungslosigkeit und Zorn, Gewalt und blutiges Geröchel. Die ganze beängstigende Metal-, Punk-, Rap- und Hardcore-Palette.
Von Ernst Jünger kann man übrigens etwas Ähnliches über den Autor lernen wie von Jochen Distelmeyer: Alles darf sein. Nebeneinander, durcheinander, gegeneinander. Surreal und widersinnig. Einen Autor muss man nicht immer verstehen. Er darf hier und da dunkel bleiben. Er braucht halt Leser, die darauf vertrauen, dass er selbst versteht – oder zumindest selbst fühlt –, was er so von sich gibt und abstrahlt. Dass er sein Wellenspiel nicht simuliert, sein Pulsieren kein Posieren, keine bloße Selbstblendung im Spiegel ist. So wie man einem Stern vertraut, dass sein Licht keine Lüge ist. Wie flackerig und fragwürdig es auch sein mag in seiner von unbekannten Kräften gebrochenen Myriadenjährigkeit.
Unsere Gesellschaft – vor allem in jenen Subsystemen, in denen Urteilskraft gefragt ist – verliert die Fähigkeit, zu unterscheiden zwischen Sachaussagen über die Wirklichkeit und Ausdrucksaussagen über die im Erlebensraum eines Ichs sich spiegelnde Wirklichkeit. Expression ist etwas anderes als Explikation oder Enunziation. Hier sind fatale Kategorienfehler vorprogrammiert.
Aus einem Essay, einer Künstlerschrift, einen Satz herauszuschneiden, eine isolierte Stelle zu inkriminieren, ist eine kulturvergessene, eine uneuropäische Barbarei. Ein Text ist ein Ganzes, eben ein Gewebe (lat. texere = weben, flechten; kunstvoll zusammenfügen). Die sprachmaterielle Basis der Textaussage ist das Gewebe in seiner Ganzheit, nicht ein einzelner fragwürdiger Satz oder ein böses Wort. Eine Pointe am Schluss eines Essays kann nicht beurteilt werden ohne die fünfhundert Sätze, die sie vorbereitet haben. Sie kann nicht bewertet werden wie ein separater Satz, der auf einem Plakat steht. Dass Journalisten und Meinungsmacher dergleichen nicht interessiert, kann ich noch verstehen. Wenn Gerichte aber über textlinguistische Grundlagen (Kohärenz und Kohäsion, Sinnzusammenhänge, semantische Strukturen, Verweis- und Wiederaufnahmeverfahren, Kongruenzen, Rekurrenzen, Variationen) einfach hinwegurteilen, wird es wirklich gefährlich.
*
NULL – Auf den Einwand, Gewaltverbrechen würden doch auch von Einheimischen begangen, und wenn die Kriminalitätsrate unter Flüchtlingen höher sei, dann nur deshalb, weil unter den Flüchtlingen halt so viele junge Männer seien, und die seien in allen Kulturen die Kriminellsten und Gewalttätigsten, entgegnete Klonovsky einmal folgendes:
„Von einem Flüchtling, also jemandem, der sich aus Lebensgefahr nach Deutschland gerettet hat und hier auf Kosten seiner großzügigen Gastgeber lebt, erwarte ich, dass er NULL Straftaten begeht, nicht mal einen Eierdiebstahl, erstens aus Dankbarkeit, sein Leben gerettet zu haben, zweitens aus Angst, bei schlechtem Benehmen wieder in die Gefahrenregion zurückgeschickt zu werden, drittens aus jenem Gebot der Anständigkeit, dass man seine Wohltäter nicht bestiehlt, beraubt, zusammenschlägt oder den weiblich gelesenen unter ihnen unaufgefordert an die Mimi fasst.“
Korrekt. Wir erwarten exakt NULL Straftaten. Ich würde in meiner Zimperlichkeit als Wohltäter noch weitergehen, und sogar NULL Ordnungswidrigkeiten erwarten. Sobald der erste Flüchtling auch nur in der Fußgängerzone auf den Boden rotzte, würden – wenn es nach meinem Verständnis von innenministerieller Akkuratesse und abendländischer Selbstbehauptung ginge – alle Hunderttausende und Millionen von Staatsgästen subito vor die Tür gesetzt.
Was natürlich zu der interessanten Frage führt: Wie lange muss jemand auf deutschem Territorium leben oder den deutschen Pass besitzen, um ebenso kriminell und asozial sein zu dürfen wie ein biodeutscher Assi, dessen deutsche Aszendenz bis ins zwölfte Jahrhundert reicht? Eine Antwort lautet, dass dies eine rein theoretische Frage sein sollte, da der Flüchtling in der Praxis längst wieder in seine Heimat zurückgekehrt sein sollte, bevor er in seinem temporären Gastland einen Apfel klaut oder einen Lehrer enthauptet.
*
Weitere Antworten (und weitere Fragen vor allem) finden sich in meinem neuen Buch:
Die Moschee im Dorf meiner Mutter – Aufzeichnungen aus einem verlorenen Land
Erhältlich bei Tredition, Amazon und bei den meisten andern Buchhändlern wahrscheinlich auch.
© Marcus J. Ludwig 2025
Alle Rechte vorbehalten