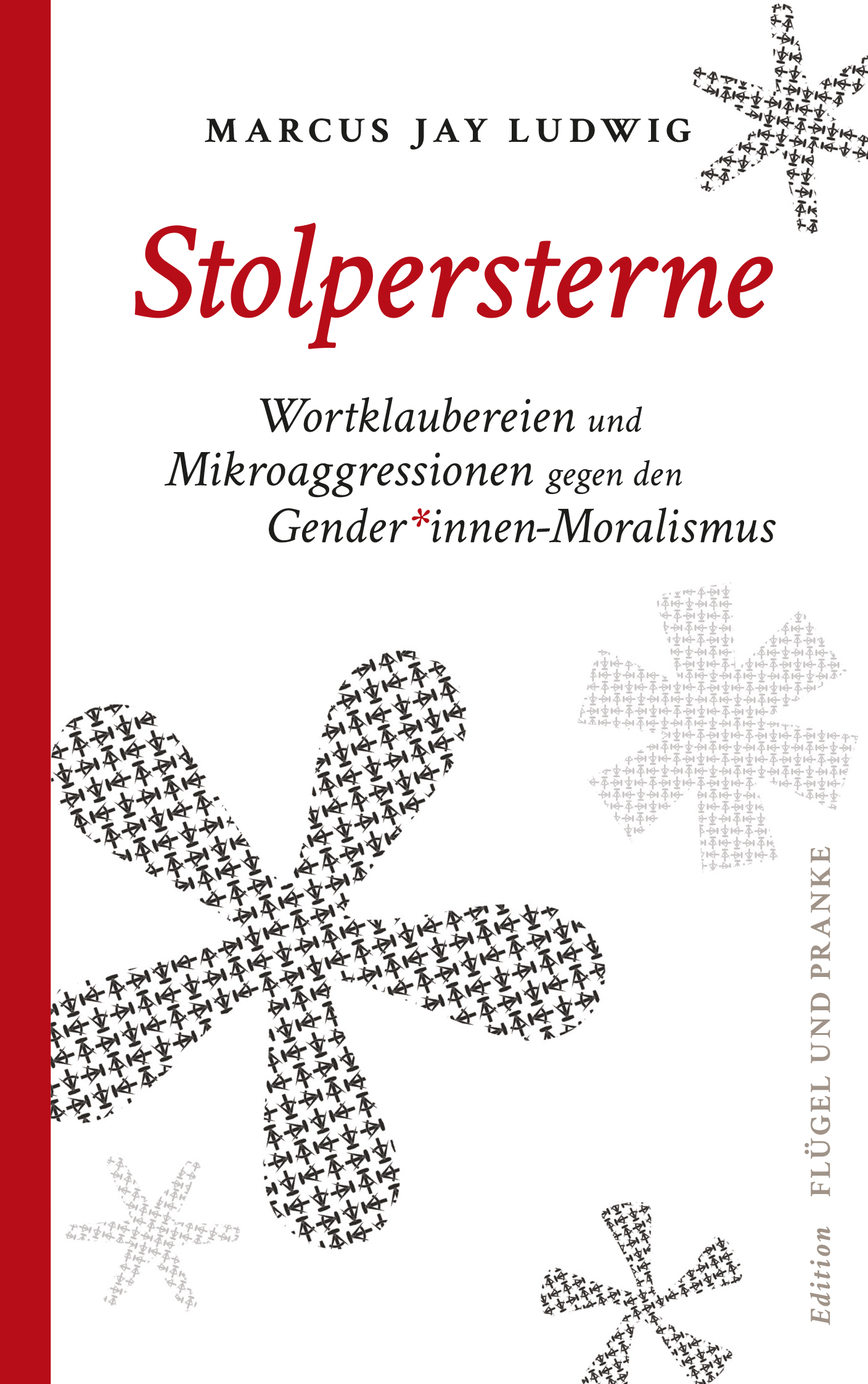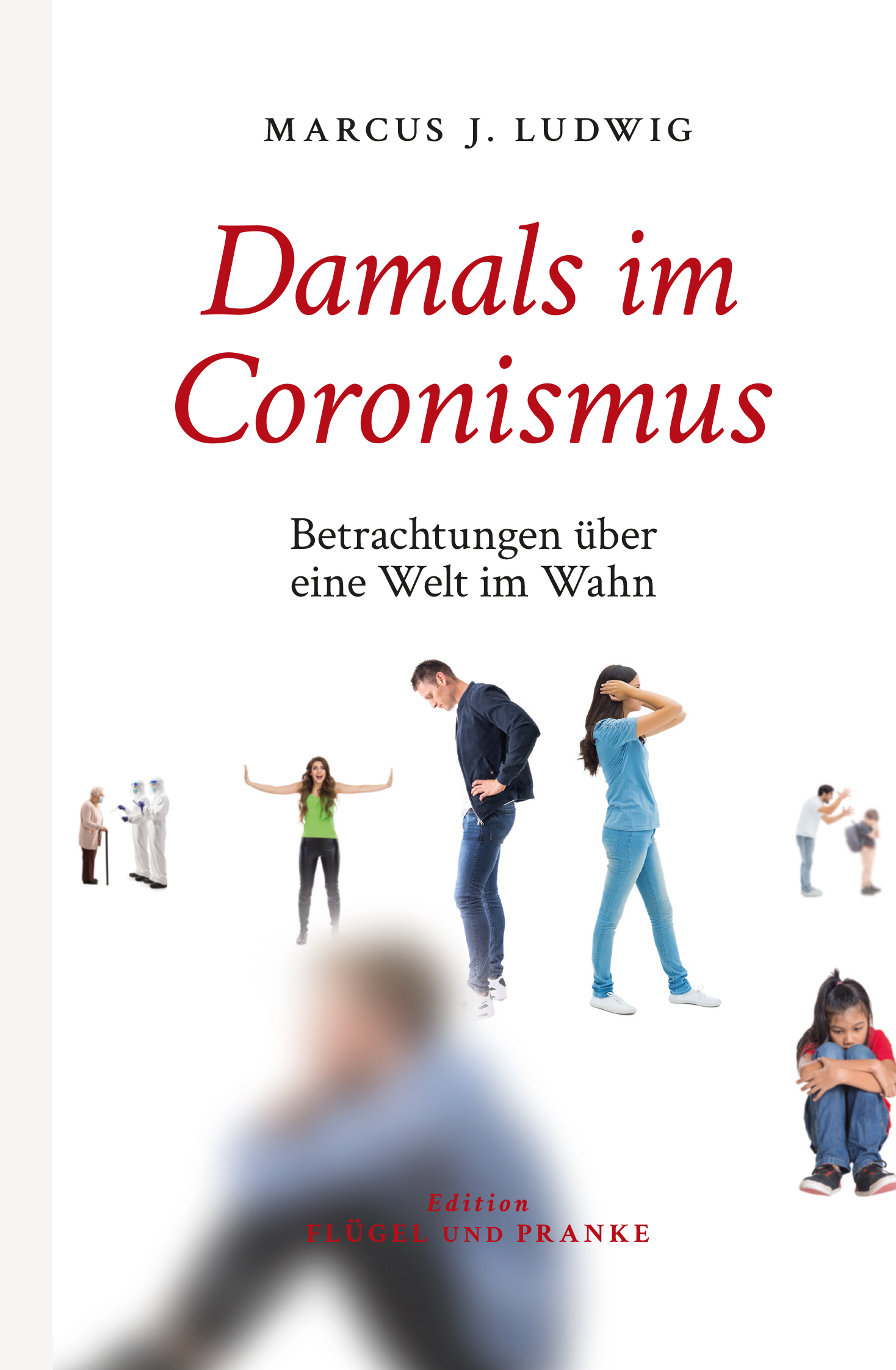„Ich will ja kein Spielverderber sein, aber sooo schlecht, wie er überall gemacht wird, ist der ZEIT-Gastbeitrag von Jan Böhmermann über die von ihm so genannten ‚Menschen von gestern‘ auch wieder nicht.“ – So wollte ich meinen Beitrag zum Thema Intellektuelle Bankrotterklärung eines woken Satirikers ursprünglich einleiten, also bevor ich den „Rundumschlag“ gelesen hatte, denn mein unbezähmbarer Widerspruchsdämon drängte mich, partout irgendetwas Positives finden zu wollen, um mich nicht an dem billigen Bashing des oppositionsmedialen Lieblingsfeindes beteiligen zu müssen. Ich wollte gern bei meiner vor Jahren schon mal geäußerten Haltung bleiben, dass der Böhmi doch immerhin als komödiantischer Musikant relativ fähig sei und dass Leute, die was können, mir irgendwie immer noch lieber seien und näherstünden als Leute, die nur rumlabern und Meinungen absondern, und überhaupt, dass man immer noch unterscheiden müsse – und zwar gerade wenn’s weh tut – zwischen Person und Werk, etc etc.
Ich muss aber nun leider beim besten Willen feststellen, dass sich, trotz aller positiven Vorurteile gegen diesen beschränkten Menschen, absolut nichts finden lässt in seinem Elaborat, was meinen Einleitungssatz rechtfertigen könnte. Der Text ist tatsächlich sooo schlecht. Es handelt sich um einen gymnasiastenhaft verbalisierten Haufen Gedankenmüll, zu dem sich jedes Wort ernsthafter Kritik verbietet. Schluss damit also.
Einzig das parteiprogrammartige Anhängsel, mit dem der Geistesschaffende seine Leserschaft auffordert, „den Menschen von gestern jene eiskalten Selbstverständlichkeiten entgegenzuschmettern, vor denen sie sich am allermeisten fürchten“, bietet willkommene Gelegenheit zu punktueller Stellungnahme. Sollte ich vielleicht keine Arbeitsenergie für verschwenden, aber, sorry, das gute alte Reiz-Reaktions-Spiel macht ja nun mal einfach auch Spaß und hilft überdies, flankiert von drei Tassen Kaffee, den morgendlich verknitterten Duselkopp ein wenig zu restaurieren.
Böhmermann schreibt (und ich kommentiere):
„Der Verbrennungsmotor ist am Ende, Elektromobilität ist die Zukunft, China baut viel bessere E-Autos als Deutschland und daran wird sich in den nächsten zehn Jahren nichts ändern.“
Elektromobilität ist die Zukunft, wenn die Energie für den Elektromotor nicht aus einer umweltkatastrophalen Batterie kommt, sondern aus einer Brennstoffzelle, und wenn der Wasserstoff für diese Brennstoffzelle mit grünem Atomstrom produziert wird.
„Inklusive Sprache ist eine prima Idee.“
Inklusive Sprache ist eine Scheißidee von barbarischen Konstruktivisten. Steht in der Top-Ten-Liste der Scheißideen etwa zwischen Impfzwang und Edeka-Wahlwerbung.
„Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist in erster Linie nicht eine linkspopulistische, demokratische oder gar linke Bewegung, sondern eine autokratische.“
Soll heißen? Sahra Wagenknecht will Alleinherrscherin werden? Bullshit. Das Problem mit dem BSW ist: Das sind Leute, die irgendwie „eine bessere Politik für die Menschen“ machen wollen. Deutschland retten wollen sie nicht. Sie wollen traditionelle SPD-Politik machen. Sie wollen keinen wirklichen Politikwechsel, keine Beendigung des allgemeinen Wahns, keinen grundsätzlichen Stopp und Neuanfang.
„Öffentliches Parken von Kfz ist viel zu billig, Bußgelder für Verkehrsverstöße sind viel zu niedrig.“
Wenn das darauf zielt, den Leuten das Auto abspenstig zu machen, bin ich dabei. Es fahren (oder stehen) auf deutschen Straßen heute dreimal so viele PKW wie vor 50 Jahren. Deutschland muss leerer werden.
„120 km/h auf der Autobahn ist schnell genug.“
Einigen wir uns auf 130 km/h.
„Google vergesellschaften, Meta regulieren, X zur Verantwortung ziehen!“
Internet komplett abschalten!
„Wer aus dem Gefühl der Abgehängtheit freiwillig Menschen von gestern wählt, darf sich nicht wundern, wenn das Gefühl der Abgehängtheit danach noch stärker wird. Es wird ganz, ganz finster werden für Sachsen, Thüringen und Brandenburg.“
Wenn es irgendwo finster wird, dann erstmal in NRW, Hessen, Bremen, etc.
„Kraftwärmemaschinen statt Wärmekraftmaschinen! Wärmepumpen sind spitze! Ihnen gehört die Zukunft!“
Ja, wenn sie Geothermie nutzen und mit Strom aus der hauseigenen Photovoltaikanlage betrieben werden statt mit naturverwüstendem Strom aus Windkraftindustriezonen, dem hässlichsten und dümmsten Strom aller Zeiten.
„Es gibt mehr als zwei Geschlechter, unendlich viel mehr Geschlechtsidentitäten, und allen Menschen stehen, unabhängig von Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung (die etwas vollkommen anderes ist!), dieselben Rechte zu.“
Erstens: Es gibt genau zwei Geschlechter. Und es gibt, wie bei allen körperlichen Entwicklungsprozessen, Fehlbildungen. Das ist sehr bedauerlich. Mir scheint, die echten Intersexuellen sind tatsächlich die größten Verlierer der ganzen abstrusen Gender-Trans-Etc.-Debatte der letzten Jahre.
Zweitens: Es gibt nicht unendlich viel mehr als zwei Geschlechtsidentitäten, sondern eine ziemlich endliche Reihe von Abweichungen von der Norm, manche aus hormonellen Unregelmäßigkeiten während der Embryonalentwicklung resultierend, manche aus frühkindlichen Traumata, manche aus pubertärer Fantasie und irregeleiteter Selbstsuche geboren, die alle von mir aus gern still und leise vor sich hin existieren können, wenn sie nur aufhören, sich uns Halbwegs-Normalos als anerkennungs-, entschuldigungs- und anbetungspflichtig aufzudrängen.
Drittens: Es stehen nicht allen Menschen dieselben Rechte zu. Ein Kind hat beispielsweise nicht das Recht, zu wählen. Ein Mensch mit pädophiler oder zoophiler oder nekrophiler Sexualorientierung hat nicht das Recht, seine sexuellen Wünsche auszuleben.
„Es heißt Schokokuss.“
Mitnichten. Es heißt … siehe Fußnote *
„Wer Alice Schwarzer hinterherläuft, hat keinen besonders anstrengenden und langen Weg mehr vor sich.“
Ich hab circa zwanzigmal versucht, den Satz zu lesen und zu verstehen, aber er ist so langweilig, dass ich jedes Mal ungefähr bei „anstrengend“ eingeschlafen bin.
„Russland muss besiegt werden.“
Böhmi an die Front!
„Wir brauchen eine Vermögenssteuer und eine signifikante Erhöhung der Erbschaftssteuer.“
Wenn du das sagst … können wir drüber reden, aber dazu bräuchte ich erst mal ein bisschen Vermögen. Hier kannst du was von deinen öffentlich-rechtlichen Millionen draufsteuern:
Marcus J. Ludwig
DE85 4305 0001 0144 0608 29
WELADEDBOC1
„Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Und private Seenotrettung auch nicht.“
Nee, erzeugt nur beides viel Stress, „atmosphärische“ Belastungen, und führt regelmäßig zu unschönen Verletzungen.
„Einander ist alles, was wir haben.“
Was genau das neue Andrea-Berg-Album mit all dem Vorigen zu tun hat, erschließt sich mir gerade nicht.
Aber wach bin ich jetzt einigermaßen. Danke.
* * *
So, und dann war ja gestern auch noch Wahl. Muss ich dazu was sagen? Na gut, bevor es ein anderer macht, zieh ich mal eben das amtliche Fazit:
1. Die Ossis sind nicht viel schlauer oder wacher als die Wessis. Sie wählen das Weiter so. Sind halt auch nur Deutsche.
2. Die gesprächsrhetorische Unprofessionalität der AfD bleibt ihr größtes Manko. Baumann, Weidel, Chrupalla – kein Wille zur Weiterentwicklung erkennbar. Höcke nur zeitweise auf der Höhe, zumeist Politiker-typische Rumdruckserei. Wie ich schon ausführlich ausführte: So wird das nix.
3. Das Heulen der Grünen, das Durchdrehen der Frau Schausten, und die Reaktion „des Auslands“ in Gestalt der New York Times ob des Erstarkens der neuen Nazis in Mitteldoitschland lässt für die Fortführung des Kampfes gegen rechts die allerunterhaltlichste Eskalation erwarten. Langweilig wird es vorerst wohl nicht.
* * *
Und hier noch – für Leser mit ganz viel Zeit und Lust – die versprochene Fußnote zum „Schokokuss“. Sie umfasst drei Kapitel eines fast zehn Jahre alten und leider immer noch unveröffentlichten antirassismuskritischen Buches namens Spielarten des Menschlichen. Versuch über die Freiheit, die Gleichheit und den Negerkuss.
Falls ein Verlag Interesse hat und sich mit diffizilen Bildrechtsfragen auskennt, einfach bei mir melden …
Kapitel 1
Der Romancier unserer Tage hat – abgesehen von sich selbst – zwei natürliche Feinde: das Internet und die Talkshow. Mächtig sind sie und todbringend, beide sind sie imstande, dem armen Künstler, der dichtend, erzählend, fabulierend etwas ins Werk zu setzen bestrebt ist, Siechtum, Auszehrung und ein Ende in Schmach und Nichtsnutzigkeit zu bereiten.
Es ist aus mit dem Schriftsteller, sobald er des Morgens den Computer hochfährt und es „vergisst“, sofort die W-LAN-Verbindung zu trennen. Er nutzt den Umstand, dass er „zufälligerweise“ aus Gewohnheit den Chrome-Button in der Taskleiste angeklickt hat, und will „nur eben schnell“ diese eine Sache nachgucken, über die er beim Aufwachen schon nachgedacht hat, nur diesen einen Namen recherchieren, sich dieses einen Zitates vergewissern, das ihm eben durch den Kopf ging, und schwupps ist es Mittag, gibt‘s ja gar nicht, und dann ist es Nachmittag, und er hat das Internet in seiner gesamten Ausdehnung bereist, aber seinen Roman hat er um kein Sätzchen weiter vorangebracht.
Es ist ebenso aus mit unserem Dichter, wenn er sich des Abends darauf einlässt, Talkshows anzusehen, denn die versetzen ihn in Zustände, deren Herbeiführung eigentlich Krätzmilben und Kopfläusen vorbehalten ist. Es juckt und brennt und schmerzt an allen Ecken, nicht auf der Haut allerdings, sondern unter der Haut, unter der Schädeldecke, unter der Rinde seines reizbaren Gehirns, und es liegt unausweichlich in der Natur der Sache, das heißt in der Struktur seines Gemüts, dass er schreibend reagieren muss, dass er nicht stillhalten kann, wenn auf solch verkürzte, verlotterte, verkümmerte Art und Weise von Themen und Problemen gehandelt wird, wie es dort bei Maischberger, Plasberg, Scobel, Lanz, auf Phoenix, im Presseclub, im Hangar 7, in Literatur- und Philosophierunden und in den freitäglichen Stuhlkreisen der dritten Programme üblich ist.
Und dann ist er tagelang, wochenlang manchmal damit beschäftigt, all das, was in den Blubberrunden der Republik dreist und gewissenlos zusammengeblubbert wird, richtigzustellen, klarzustellen, der Gedankenlosigkeit und verbalen Ohnmacht der Fernsehinsassen etwas Brauchbares, das heißt Geistreiches und redlich Erwogenes, vielfach Reflektiertes, streng und peinlich Durchgrübeltes entgegenzusetzen.
Hier und da widersteht er dem Drang zu intervenieren, weil er natürlich weiß, dass sein Beitrag nichts ändern wird am Lauf der Welt und an den Motiven der Machthaber über die öffentliche Meinung.
Er betäubt den kognitiven Juckreiz mit Musik und Sport und wendet sich dann wieder dem wirklich Wichtigen zu, seinem riesenhaften, pracht- und kunstvollen Romanprojekt, das ihm dereinst Ruhm und Nobelpreise einbringen wird.
Wenn aber beide Todfeinde sich zusammentun, dann ist es wirklich endgültig aus. Wenn der Schriftsteller, von dem hier bislang die Rede war, und von dem nicht ganz sicher zu sagen ist, ob man ihn überhaupt so verallgemeinernd als den Schriftsteller bezeichnen darf oder ob er nicht vielleicht nur in dem einen Exemplar vorkommt, welches hier gerade schreibt – wenn also dieser bedauernswert leicht anregbare und ablenkbare, dieser möglicherweise sogar insgeheim nach Ablenkung aktiv suchende Schriftsteller sich des Vormittags im Netz verfängt, weil er kurz nebenbei etwas zum Stichwort „Rassismus“ googeln wollte, und dann des Abends auch noch in eine Fernsehdiskussion gerät, in welcher mal wieder die stets vergnüglichen Rechts- und Anstandsfragen rund um den „Negerkuss“ erörtert werden und in der – obwohl Philosophen und Philologen am Tische sitzen – mal wieder gar nichts geklärt wird, dann besteht wohl Grund und Anlass genug, die Arbeit am Roman kurz einzustellen, um einen konzentrierten Kontrollgang durch das reichlich verminte Grenzgebiet zwischen Süßspeisenonomastik, Tugendterrorismus und Rassenkunde zu unternehmen.
Bringen wir ihn denn also in Gottes Namen hinter uns.
Wir nähern uns dem unwegsamen Komplex zunächst von der konditorischen Seite: Das Objekt, welches man in gedankenlosen und hartherzigen Zeiten allenthalben als „Negerkuss“ zu bezeichnen pflegte, besteht im Wesentlichen aus gesüßtem Eiweißschaum, der ungefähr in Form eines abgeplatteten astronomischen Observatoriums auf ein rundes Waffelfundament aufgebracht wird. Dieses Gebilde, zumindest in seiner traditionellen Machart und Erscheinungsweise, erfährt sodann eine Beschichtung mit einer hauchdünnen Schokoladenglasur.
Die Farbe ebendieser Schokolade hat offenbar den Namensgeber, also den Volksmund, zu einer Assoziation mit der Haut afrikanischstämmiger Menschen bewogen. Warum auch immer. Es war nicht deutsche Kälte und Gemeinheit, die solches gebar, es lag wohl in der Luft des Zeitalters, denn auch der Franzose aß gern seinen „Tête de nègre“, und der Däne, der’s angeblich erfunden hat, nannte das dunkle Nutriment „Negerbolle“.
Wir nehmen vorläufig und unter Enthaltung jeglicher Wertung zur Kenntnis, dass es Epochen gab, in denen offenbar die nächstgelegene Verkörperung des Begriffs „braun“ nicht der Nazi, nicht das zum Fluchen meistverwendete Stoffwechsel-Endprodukt und nicht das Nussbaumklavier war, sondern der ehedem sogenannte Neger.
Einschub: Wie man bereits festgestellt haben dürfte, benutze ich das Wort „Neger“ in diesem Text ausgiebig. Es geht hier schließlich um Worte und um die Frage, ob man Dinge, die man sieht, benennen darf, und wenn ja, mit welchen Worten. Zum Glück gibt es aber auch noch Menschen, die sich weniger roh und barbarisch zu benehmen wissen als ich. Der Sprachwissenschaftler und Political-Correctness-Aktivist Anatol Stefanowitsch etwa spricht in einem ZEIT-Interview nur vom N-Wort. Selbst im Meta-Modus der Analyse und Kritik wird das böse Wort, als habe es dämonische Geheimkräfte, nicht ausgesprochen, auch nicht in Anführungszeichen.
Man könnte solch zarte Rücksichtnahme belächeln. Das Problem aber ist, dass damit ein bedenklicher Informationsverlust einhergeht. Während beim fast ebenso schlimmen Z-Wort immerhin noch klar ist, dass „Zigeuner“ gemeint ist, weiß man beim N nicht, ob „Neger“ oder „Nigger“ gemeint ist. Das wäre aber für eine differenzierte Diskussion doch ganz hilfreich.
Merkwürdig ist, dass die Menschheit auch noch an der Negerhaftigkeit der Speise festhielt, als es schon längst solche mit weißer Schokolade gab. Spätestens seit deren Erfindung hätte sich jeder um linguistische Akkuratesse bemühte Patissier – oder doch zumindest die Kundschaft – Gedanken um eine Neubenennung machen müssen.
Aber gemach, wir greifen vor. Die erste kritische Frage soll nämlich nicht dem Wortbestandteil „Neger-“ gelten, sondern dem mindestens so fragwürdigen „-kuss“: Was um alles in der Welt ist an diesem Teil eigentlich im Entferntesten kussartig?
Auch an dieser Stelle fallen einem Parallelphänomene ein, die allerdings zur Erhellung wenig beisteuern: Es gibt das bekannte Ferrero Küsschen, und es gibt einen Markenclaim für das Mischgetränk Mezzo-Mix, der da lautet: „Cola küsst Orange“. In diesem Fall ist immerhin die Subjekt-Objekt-Relation einigermaßen offensichtlich. Was aber genau ist am Ferrero Küsschen das Kussartige? Und wer wird beim Negerkuss von wem geküsst? Es ist extrem rätselhaft. Man kann nachdenken, so viel man will, man findet keine auch nur annähernd überzeugende Erklärung …
– Wird der, der den Negerkuss isst, vom Neger geküsst?
– Küsst der, der den Negerkuss isst, den Neger?
– An welcher Stelle der Vorstellung, die mit dem Namen verbunden ist, findet überhaupt irgendetwas wie ein Kuss statt? Selbst wenn der Esser, bevor er in das Gebilde beißt, seine Lippen spitzte und dem Schokoding einen Kuss verabreichte, wäre es unangemessen, das Ding selbst als einen Kuss zu bezeichnen. Man beißt in einen Kuss? Was soll das bedeuten?
– Wenn es umgekehrt gedacht sein sollte, und man also in den Neger beißt und dann, wenn man ihn zwischen den Lippen hat, etwas wie einen Kuss verspüren soll, wäre das nicht doch ein Umstand, der die Speise als Gaumenfreude für die lieben Kleinen etwas fragwürdig erscheinen ließe?
Allein diese unlösbaren Fragen hinsichtlich des „Kusses“ reichen eigentlich schon. Wir brauchen überhaupt keine Political-Correctness-Argumente, um uns zu dem dringlichen Verlangen getrieben zu sehen: Das Teil braucht einen anderen Namen!
Aber just da stellen wir fest: Das Teil hatte ja immer schon einen anderen Namen. Wenn auch einen ähnlich rassenbezogenen Namen, der aber immerhin in seiner sprachbildlichen Anschaulichkeit dem ersten klar überlegen ist: „Mohrenkopf“.
Wir lassen kurz außer Acht, ob der „Mohr“ das Gleiche bezeichnet wie der „Neger“. Tatsache aber ist, dass er erstens hübsch altertümelnd anmutet und zweitens kaum als Grundlage für sprachliche Weiterbildungen mit abwertendem Charakter taugt. Während man aus dem „Neger“ den „Nigger“ machen kann, kann man aus dem „Mohr“ gar nichts machen (es gab früher Omas, deren Katzen „Mohrle“ hießen, ich bin nicht sicher, ob das eine Koseform für ein schwarzes Tier war – ganz unplausibel wäre es nicht).
Käme der Mohr also für die Benennung des Schaumkusses weiterhin in Betracht? „Mohr“ ist ja eigentlich nur eine völlig harmlose und neutrale Herkunftsbezeichnung. Es handelt sich um eine Eindeutschung des „Mauren“, also eines mäßig dunkelhäutigen Menschen aus dem alten Mauretanien, was etwa dem heutigen Marokko entspricht.
Sieht aber ein herkömmlicher Schaumkuss wirklich aus wie ein Marokkaner? Die Frage stellen, heißt sie beantworten. Der Begriff „Mohrenkopf“ ist nicht wirklich rassistisch, aber er drückt nicht korrekt aus, was ausgesagt werden soll. Insofern scheidet er für weitere Erwägungen aus.
Der „Neger“ hinwiederum ist eigentlich auch eine harmlose, aber tatsächlich ebenso unzutreffende Bezeichnung für einen dunkelhäutigen Menschen. „Niger“ bedeutet ja nichts weiter als schwarz. Was vollkommen wertfrei ist. Es ist nur leider falsch hinsichtlich realer menschlicher Pigmentierungsvarianten. Denn es gibt keine schwarzen Menschen. Genausowenig wie es weiße Menschen gibt.
Es gibt vielleicht vereinzelte Menschen, die bei sehr schlechter Beleuchtung fast schwarz wirken, aber eigentlich alle Personen, die man so als Farbige, Afros oder Neger kennt, sind mehr oder weniger braun. Wer Obama für einen Schwarzen hält, der halte ihn mal neben Ranga Yogeshwar oder Christiano Ronaldo.
Barack Obama, Ranga Yogeshwar und Ronaldo haben ungefähr den gleichen Hautton. Obama als Schwarzen, als Neger oder auch nur als Farbigen zu bezeichnen, ist ziemlich absurd. Trotzdem ist natürlich ohne Weiteres zu erkennen, dass er einen afrikanischen Abstammungshintergrund hat, so wie man auch sieht, dass Yogeshwars Vorfahren aus Indien kommen und Ronaldos aus Südeuropa.
Es reichen einige Blicke in anthropologische oder rassenkundliche Bücher, es reichen fünf Minuten Google-Bildersuche und die Betrachtung des sehr sehenswerten Fotoprojektes „Humanæ“ von Angélica Dass, um zu der Einsicht zu gelangen, dass die Hautfarbe bei Weitem nicht zur Typisierung reicht.
Kapitel 2
Es war zu befürchten, dass die Sache kompliziert wird. Man verirrt sich heillos in einem Begriffsgestrüpp aus Wörtern, die man einerseits frech und trotzig benutzen will, die aber nur inkorrekt wiedergeben, was man korrekterweise eigentlich sagen müsste, obwohl man ebendies nach herrschender, also „correcter“ Meinung gar nicht sagen dürfte, weil es gar nicht existieren soll, und so weiter.
Aber fassen wir uns. Fassen wir Mut, wir haben uns eh schon zu weit vorgewagt, als dass wir den handelsüblichen Rassismusvorwürfen noch entgehen könnten. Frisch vorwärts also, jedes Fettnäpfchen, jedes Steinchen des Anstoßes sei uns auf unserem weiteren Wege willkommen!
Wie sollen wir die Menschen nennen, die unsere Eltern und Großeltern (einschließlich übrigens solch feinsinniger Menschenfreunde wie Martin Luther King, Theodor W. Adorno und Alexander Mitscherlich) noch – ohne sich viel dabei zu denken – „Neger“ nannten? Wenn wir dem DUDEN glauben dürfen, haben in Deutschland lebende Menschen dunkler Hautfarbe als Eigenbezeichnung „Afrodeutscher, Afrodeutsche“ gewählt. Diese setze sich immer mehr durch. (DUDEN – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 4. Aufl., Mannheim 2012)
Mit dem „Afrodeutscherkuss“ wären wir also in Sachen Political Correctness auf der sicheren Seite. Nur leider, etwas sperrig klingt er schon. Und die korrekte Handhabung der Binnenflexion ist auch nicht unbedingt jeder Konditoreifachverkäuferin ohne Weiterbildung zuzumuten. Sagt man: „Möchten Sie zu den fünf Dinkelbrötchen noch fünf Afrodeutscherküsse dazu?“? Oder heißt es „Afrodeutschenküsse“? Oder „Afrodeutscheküsse“?
Konflikt- und Blamagepotential zuhauf. Gestehen wir es uns ein: Hier ist kein gangbarer Weg.
Die Bezeichnung „Afro-Deutscher“ oder „Afro-Amerikaner“ ist aber ohnehin für jeden, der willens ist, drei Sekunden lang nachzudenken, völlig unbrauchbar. Was ist mit Deutschen oder Amerikanern, deren Vorfahren Ägypter, Libyer, Algerien, Tunesier, Marokkaner, mithin also Bewohner Afrikas waren? Die werden sich schön bedanken, wenn man sie „Afro-Deutsche“ nennte. Und warum? Weil sie offensichtlich zur europiden Rasse gehören. Und selbst viele Ostafrikaner, Äthiopide, Nilotide etc., entsprechen morphologisch stärker dem europiden als dem negriden Erscheinungsbild. Es ist also schlicht unsinnig, eine Menschengruppe nach einem Kontinent zu bezeichnen. Sind Russen, Anatolier, Israelis Asiaten? Ja, geografisch schon, aber das meinen wir ja nicht, wenn wir von Asiaten sprechen. Wer an Asiaten denkt, denkt an Chinesen, Koreaner und Japaner. Rassenkundlich gesprochen also an Mongolide.
Und wer von Afrikanern spricht, meint in der Regel Negride. Diese Rassen sind – auch wenn alle gutmenschlichen Moralisten es gerne anders hätten – keine Fiktion. Es gibt haufenweise Übergangsformen, aber das ändert nichts daran, dass es eben Übergänge zwischen existierenden Rassen sind, oder zwischen Geotypen, was schon mal ein neutralerer und deeskalierenderer Terminus wäre.
Es würde sich überhaupt lohnen, über neue Bezeichnungen nachzudenken, denn ein Ausdruck wie „Negride“ ist, wie gesagt, höchst unbefriedigend. Der Subsahara-Afrikaner ist erstens nicht schwarz, sondern hell- bis dunkelbraun und zweitens gibt es andere Typen, die ähnliche Hauttöne aufweisen (Inder, australische Aborigines), die aber nicht zu den Negriden gehören. Vielleicht sollte man die Rassen oder Typen einfach nur mit Zahlen versehen, um jegliche begriffliche Fragwürdigkeit zu umgehen.
Vielleicht sollte man, statt von Rassen oder Geotypen, Erscheinungsformen, Formenkreisen, Varietäten oder Subspezies zu reden, vielleicht sollte man bei all dem Halbwillkürlichen und Unentscheidbaren, bei all dem Schwanken zwischen Biologie und Ästhetik, bei all dem eher bloß Interessanten als Praxisrelevanten, vielleicht sollte man bei all dem Unverbindlichen und Spielerischen, welches diesem ganzen frivolen Faszinosum des Sammelns von Gesichtern, des Suchens von Sonderbarkeiten, des Betrachtens von fremder Vertrautheit innewohnt, vielleicht sollte man bei solchen wissenschaftlichen Kindereien einfach von Spielarten des Menschlichen sprechen.
[Es folgen im Buch mehrere eher ernst gehaltene Kapitel über die Frage, ob es Rassen gibt und was Antirassisten eigentlich genau bekämpfen.]
Kapitel 13
So. Was machen wir nun nach all dem mit dem gottverdammten Negerkuss? – Da ich nicht zu denen gehöre, die immer nur kritisieren und dekonstruieren, will ich auch gern eine Lösung des eigentlichen Problems anbieten, und zwar in Form eines Namensvorschlages, der sich zweifellos in kürzester Zeit durchsetzen wird.
Schokohupf. Das war mein erster Einfall. Nur leider: In den einschlägigen Backrezept-Foren im Internet gibt es den schon, es handelt sich naheliegenderweise um einen Gugelhupf mit Schokolade. Schade.
Das Hupfartige aber, also das rundlich in die Höhe sich Erhebende, steckt auch in dem sprachgeschichtlich verwandten Hügel, Hubbel und Hubel. Der Schokohubel wäre damit ein durchaus wohlklingender Kandidat.
Allerdings kommt uns hier das Lebensmittelrecht in die Quere, welches fordert, dass Speisen, die den Begriff Schoko im Namen führen, auch tatsächlich echte Schokolade auf Kakaobutterbasis enthalten müssen. Bei den zeitgenössischen industriell gefertigten Produkten besteht die Kuvertüre jedoch meist aus Fettglasur.
Die daraus sich ergebenden Namen Fettkopf oder Glasurkuss will wohl niemand, der bei Trost ist, auf die Liste der ernsthaft diskutablen Vorschläge setzen. Fettglasurhupf oder Fettglasurhubel sind – seien wir ehrlich – auch nur geringfügig appetitlicher.
Okay, halten wir zumindest den Hupf fest. Wir brauchen nur ein passendes Bestimmungswort. So schwer kann das nicht sein.
Wollten wir vielleicht doch einfach dem Duden vertrauen, der ja ganz klar sagt, dass Afro ein akzeptierter und gern gehörter Wortbestandteil ist, so käme der Afrohupf ganz stark in Betracht, denn auf diese Form des Hupfes ist laut Internetrecherche noch niemand gekommen. Afrohubel ginge natürlich ebenso. Das ist für jedermann an der Konditoreitheke leicht aussprechbar und verhilft Kunde und Personal zu heiterer Laune.
Jedoch, ich wähne, dass auch damit der eine oder andere junggrüne Fürsprecher unserer Mitbürger mit afrikanischem Migrationshintergrund seine Probleme haben könnte. Es klingt für Leute mit eingeschränktem Humor wohl irgendwie zu lustig, und die Menschen wollen keine Lustigkeit bezüglich irgendwelcher körperlichen Eigenarten. Man möchte ernstgenommen werden mit seinen Abweichungen, man ist empfindlich gegen vermeintliche Respektlosigkeiten, seien sie auch noch so harmlos.
Die Frage ist aber auch irgendwie berechtigt, ob man überhaupt die Eigenarten oder ethnischen Spezifika von Menschen zur sprachbildlichen Umschreibung von Lebensmitteln heranziehen muss. Das Zigeunerschnitzel ist ja auch so ein Fall, an dem sich die Gemüter erhitzen. Das Sinti-und-Roma-Schnitzel ist keine wirklich brauchbare Alternative. Auf der nächsten linguistischen Eskalationsstufe findet man das Synthesizer-Schnitzel, aber das ist nur noch einem elitären Kreis von Liebhabern absurdester Komik halbwegs verständlich.
Was also tun? Der Mensch hat offenbar ein Bedürfnis, seine Nahrung über die Nennung der bloßen Bestandteile hinaus, irgendwie personal-anschaulich zu kennzeichnen.
Ein Schnitzel mit pilzhaltiger Sauce ist dann eben ein Jägerschnitzel. Es könnte genauso gut ein Pilzsaucenschnitzel sein. Aber allem Anschein nach verströmt der Assoziationskreis Jäger, Wald, Natur, Draußen, Pilze eine gewisse erdige Gemütlichkeit, die dem Genuss des panierten Leichenteiles wohl irgendwie förderlich ist.
Das Zigeunerschnitzel mit seinen Konnotationen Balkan, Paprika, feurige Würze, sorgt für eine leicht exotische, bunte Behaglichkeit. Auch hier könnte man Vernunft walten lassen und das Gericht schlicht Paprikasaucenschnitzel nennen oder Balkanschnitzel oder auch einfach Ungarnschnitzel. Als ob der gemeine Schlemmerbüdchen-Deutsche wüsste, wo die Zigeuner herkommen, und als ob er zwischen Ungarn und Balkan unterscheiden könnte. Alles mit Paprika ist irgendwie ungarisch … Aber wir schweifen ab. Zurück nun zum Patisserie-Problem.
Am sinnvollsten wäre es wohl, den Hupf, statt ihn durch eine Rasse oder einen Typus oder eine Bevölkerungsgruppe zu charakterisieren, mit einem personalen Bestimmungswort zu versehen. Wir brauchen einen prominenten Paten.
Und – wieso kamen wir da nicht gleich drauf? – da gibt es doch den, Zitat Joachim Herrmann: „wunderbaren Neger“ Roberto Blanco. („Hart aber fair“, 31.08.2015)
Man könnte Herrn Blanco fragen, ob er es als Ehre empfinden würde, wenn das süße Schaumding nach ihm benannt würde. Da er als humorvoller Heiterkeitsspender gilt, ist es nicht ganz abwegig, dass er dem Blancohupf seinen Segen erteilte.
Von mir aus könnte er auch selbst entscheiden, ob er Blancohupf, Blancokopf oder Blancokuss bevorzugt. Hauptsache: Dreisilbig muss er sein, mit Betonung auf der ersten Silbe: Ne-ger-kuss, Moh-ren-kopf, Blan-co-hupf. Ufftata, Walzerschritt, Daktylus. Aber das wird er als Musiker zweifellos ohnehin im Gefühl haben.
Und ganz nebenbei erfüllt der Blancohupf sogar das Kriterium der Helle-Kuvertüre-Kompatibilität.
Mehr kann man eigentlich nicht verlangen.
© Marcus J. Ludwig 2024
Alle Rechte vorbehalten