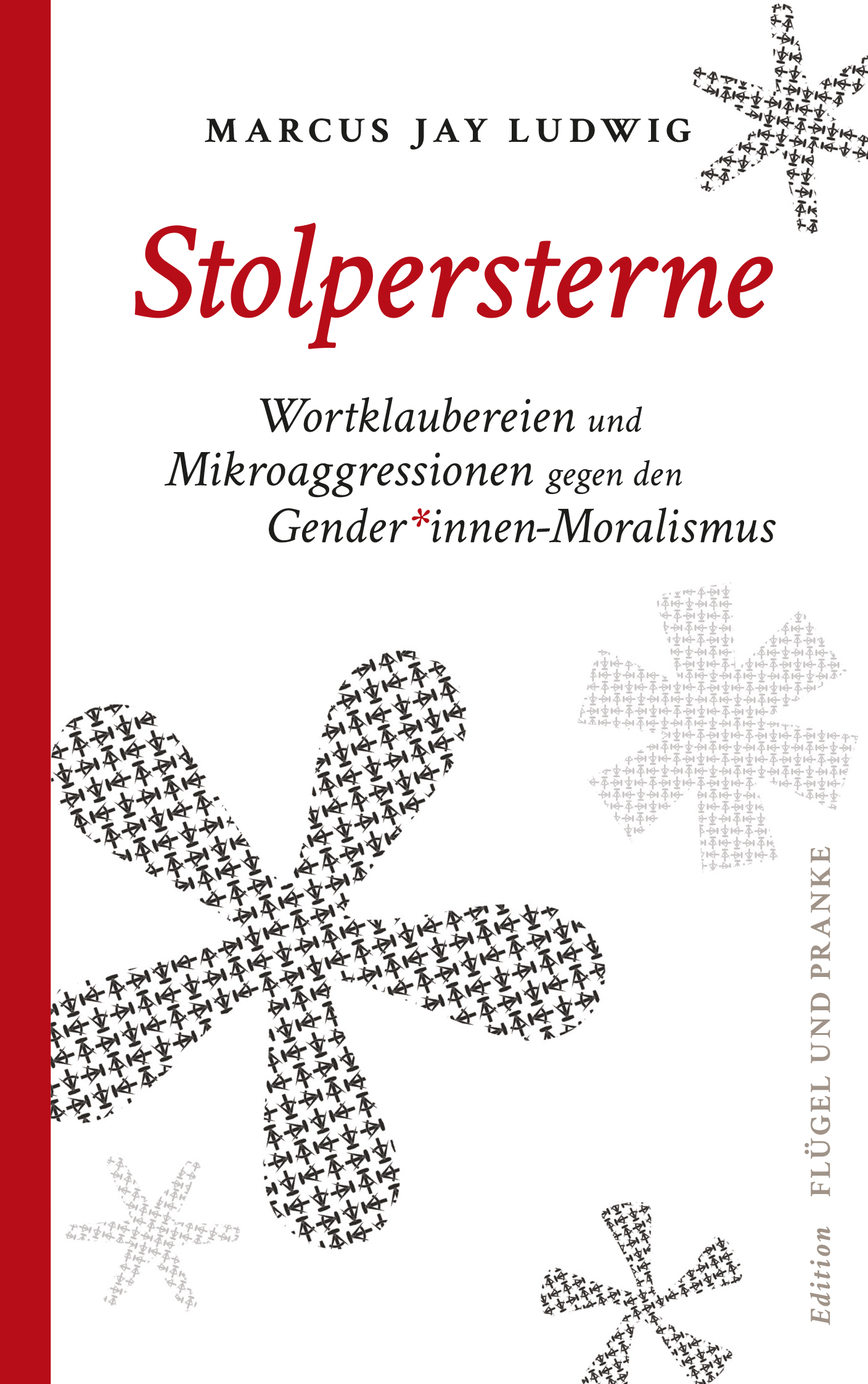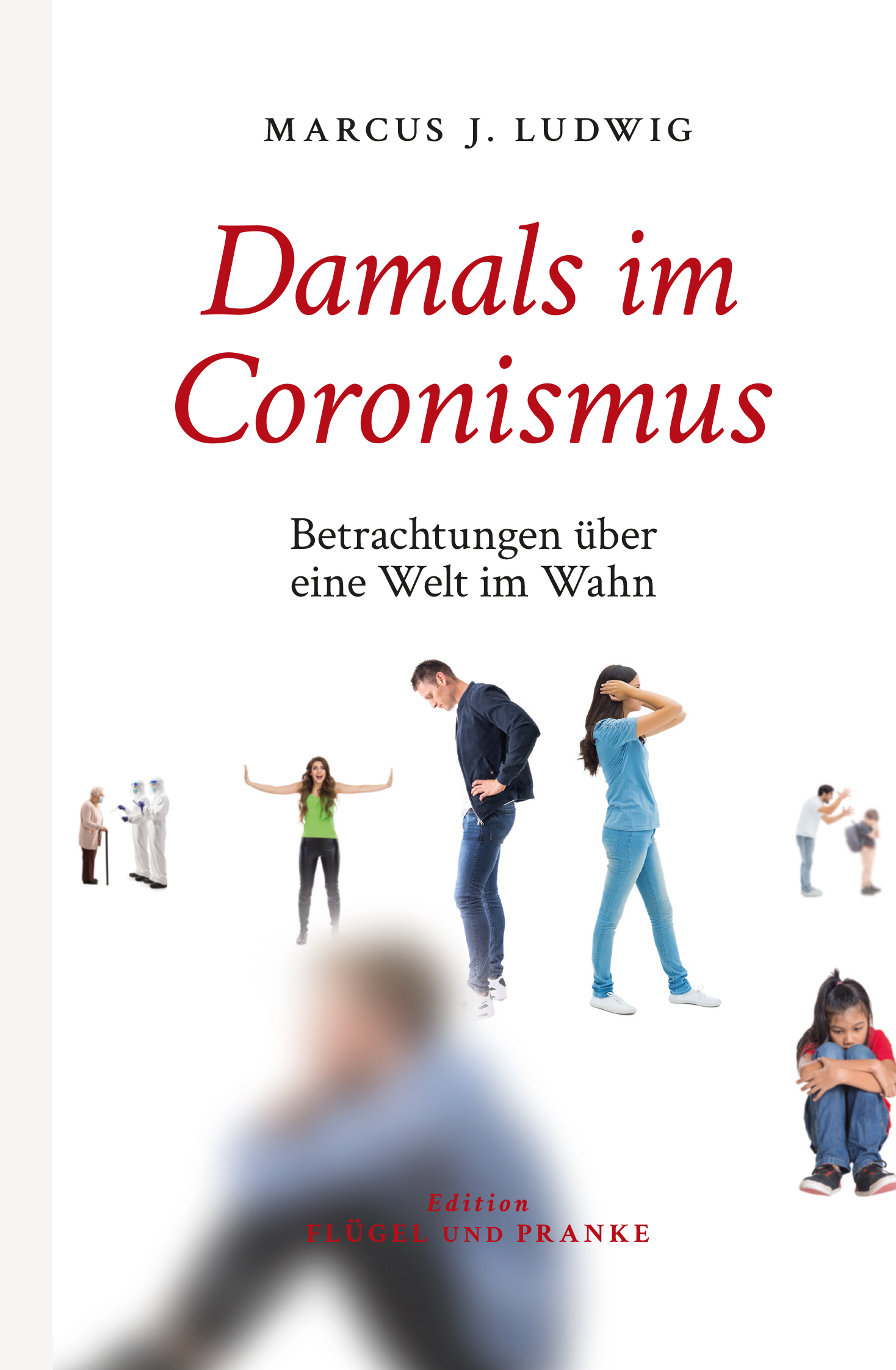Zum Tod von Stefan Mickisch
– – –
Es gibt ein paar Menschen auf der Welt, von denen ich mir zuweilen vorstelle, wie es wäre, sie kennenzulernen … nicht so als flüchtiges Meet-and-Greet von Fan zu Star, sondern als echte Begegnung, als Auftakt einer neuen, hochgestimmten Lebens- und Werkphase, als Richtigstellung ganz unsinnigerweise separater Lebensläufe, als eine Realisierung lang geahnter Wahlverwandtschaft. Ich weiß wohl, dass es hier eher Wahnverwandtschaft heißen müsste, denn diese paar Menschen kennen mich ja gar nicht, und wenn ich bei denen an der Tür klingelte, um ein neues Leben einzuläuten, würden sie gewiss eher die Polizei rufen, als mich feierlich hereinzubitten, um Pläne zu schmieden und die Sternenfreundschaft von Nietzsche und Wagner neu zu interpretieren.
Einer von diesen paar Menschen, sehr weit oben auf meiner Liste der utopisch Umträumten, war Stefan Mickisch. – War. – Ich erfuhr gestern, dass er tot ist. Ich erfuhr es mit einiger Verspätung aus den alternativen Medien, denn den etablierten „Qualitätszeitungen“ war der Verlust dieses einzigartigen deutschen Musikers und Menschenbeglückers keine Nachricht wert. Es passt zum Gesamtbefund unseres kulturellen Verdorrens, zu den verpennten, ignorierten oder notdürftig abgearbeiteten Jubiläen der letzten Zeit, Hölderlin, Haushofer, Westphal, Mickisch … keine Staatsakte, keine Sonderausgaben, keine Denkmäler, keine Öffentlichkeit, der das Leben diesseits des Konsums irgendwas bedeutet. Die deutsche Kultur ist komplett am Boden. Auch ohne Corona.
Ich weiß nicht, ob ähnlich geartete Düsterkeiten zu Stefan Mickischs Ende beigetragen haben, man munkelt von Freitod, und das scheint mir nicht völlig abwegig, aber bislang weiß die Welt nichts, es kann auch der banale Herzinfarkt gewesen sein, organische Entladung von Zorn und Verzweiflung über den anhaltenden Zustand, den er „Corona-Faschismus“ nannte. Es kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Lassen wir das.
Für mich persönlich macht es die Sache schwieriger, trauriger, vielleicht aber irgendwann auch einmal tröstlicher, dass mein „Anklingeln“ bei Mickisch nicht vollständig im Bereich der Fiktion verblieb. Ich schrieb mal einen Text über ihn (s.u.), den ich zu seinem Geburtstag veröffentlichte. Nachdem zunächst keine Reaktion kam – mit der ich bei dem Vielbeschäftigten auch nicht so wirklich rechnete –, schrieb er mir nach einigen Monaten eine überschwängliche Dankesnachricht, nein, nicht eine, sondern gleich drei, in denen er nicht nur seiner Begeisterung darüber Ausdruck gab, dass endlich mal einer etwas Richtiges über ihn formuliert habe, sondern mir auch gleich von seiner Hochzeit berichtete, seinen Konzertaktivitäten, von Bayreuth, von seiner Schopenhauer- und Nietzsche-Lektüre, und mich dann auch noch um Zusendung meiner sämtlichen Bücher bat, ob ich nicht vielleicht tauschen wolle, gegen ein paar seiner CDs.
Er schrieb mir diese Mails im Mai des letzten Jahres, aus einem Wiener Hotel, wo er Lockdown-bedingt wochenlang festsaß. Als einziger Gast. Immerhin war es das Grand Hotel am Kärtnerring, und immerhin hatte man ihm einen Bösendorfer organisiert. Und er sprach da schon vom „CoronaFaschismus“, was ihm schließlich zur (schon länger sich anbahnenden) Exkommunikation aus dem politisch korrekten Kulturestablishment gereichen sollte. Ich antwortete, ich hielte das Ganze eher für eine „Corona-Hysterie“ und ich sei noch unschlüssig, ob wir es mit einem Wahn oder mit wirklicher politischer Bösartigkeit zu tun hätten. Aber im Grunde interessierte mich dieser Punkt damals gar nicht so sehr, ich war noch in der Lage, mich auf andere, wichtigere Dinge zu konzentrieren. Und wichtig in den Mails von Mickisch war mir vor allem sein Satz: „Ich fühle mich verstanden.“
Es beglückt mich ein wenig in meiner Erschütterung, in diesem ordnungswidrigen Aufruhr von Trauer und Frühjahrssonne, von Menschheitswut und Waldweben, zu wissen, dass ich diesem großen Künstler einmal so nah war, dass er sich von mir verstanden fühlte.
Dass er nun nicht mehr da sein soll, kann ich nur sehr schwer verstehen.
Zum Gedenken hier noch einmal der kleine Huldigungstext aus dem Jahr 2019:
Der Meister von Schwandorf
Der Begriff Meister, wie ich ihn verstehen und gebrauchen möchte, drückt besonders schön und atmosphärisch sehr genau aus, wie ein Objekt der Verehrung beschaffen sein muss, damit man es emotional ungestört verehren kann, und nicht etwa gar lieben muss oder nur so ganz okay finden kann.
Der Meister reicht ja in seiner Bedeutungs-Bandbreite ungefähr vom prophetenförmigen Sektenführer bis zum Facility Manager. Die hausmeisterlichen Künste sind ohne Frage dankens- und anerkennenswert, und die Weisheit und der Zorn des religiösen Oberhauptes mögen ehrfurchtgebietend sein, doch Anerkennung und Ehrfurcht sind nicht dasselbe wie Verehrung. Jemandem, den man verehrt, drückt man weder fünf Euro Trinkgeld in die Hand, noch fällt man vor ihm auf die Knie.
Wäre man bei der SPD oder beim WDR oder in einer Abi-Klausur, müsste man jetzt irgendwas von Begegnung auf Augenhöhe schreiben. Bei anderen Parteien, Sendern und Veranstaltungen, wo man genötigt wird, sich gesellschaftsmentalitätskonform zu irgendwas zu äußern, natürlich ebenfalls. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen meinen, Größenunterschiede sehr schlecht ertragen zu können. Deshalb sollen Begegnungen immer auf Augenhöhe stattfinden. Gemeint ist eigentlich auf gleicher Augenhöhe, aber wir wollen bei Abiturkandidaten und Talkshowmoderatoren nicht jede Plapperphrase auf die semantische Goldwaage legen.
Die Begegnung mit einem Meister wie Stefan Mickisch entbindet uns von dem leidigen Augenhöhenzwang. Wobei diese Entbindung auch durch die Tatsache, dass die Begegnung in allererster Linie eine akustische ist, enorm gefördert wird. Die Formulierung „ein Meister wie Stefan Mickisch“ ist natürlich bar jedes Sinns. Es gibt keinen Meister wie Stefan Mickisch. Dieser Mann steht als Künstler, als Kunst-Vermittler und -Erklärer, vor allem aber als Virtuose und Könner auf seinem Gebiet so einzigartig da und so haushoch über allem, was man sich vorstellen kann mit eigenen Händen je zu leisten, dass die Augen sich automatisch nach oben richten.
Das Schöne an ihm ist, dass man – da bin ich einigermaßen sicher – durchaus auf gleicher Augen- und Maßkrughöhe ein Bier mit ihm trinken und über Wagners Antisemitismus diskutieren könnte. Aber wenn er anfängt Klavier zu spielen und Musik zu erklären und der Flügel sich unter seinen Händen in ein Orchester verwandelt, nicht in irgendeins, sondern in ein ideales Orchester, in dem alle Musiker perfekt zusammenspielen, wo Timing, Tuning, Dynamik, Ausdruck wie aus einem Guss sind, weil sie eben aus einer Hand, das heißt aus zwei Händen kommen, wenn er also das tut, was kein Mensch außer ihm kann, dann ist er der Meister, der große Meister Stefan Mickisch, und die Augenhöhe spielt dann ohnehin keine Rolle mehr, weil die Augen des Verehrenden niedergeschlagen und voller Tränen sind.
Ich habe Stefan Mickisch und seine Kunst vor etwa drei oder vier Jahren entdeckt, aber aus dem Staunen und dem Bewundern herausgekommen bin ich bis heute nicht. Wer je seine Version des Parsifal-Vorspiels auf Wagners Steinway gehört hat, wird wissen, wovon ich rede. Und wer bei 3 min 52 sec nicht den Himmel offen sieht und von gleißenden Engelsschwärmen durchflutet zu schluchzen beginnt, der ist kein Mensch. Wenn es je nötig werden sollte, innerhalb irgendeines real sich zutragenden Science-Fiction-Szenarios die äußerlich als Menschen getarnten außerirdischen Invasoren von den Erdbewohnern zu unterscheiden, dann ist das Vorspielen dieses Stückes die sichere Methode zur Feststellung der Zugehörigkeit zu unserer Spezies.
Ich verzichte darauf, das, was Stefan Mickisch musikalisch produziert, näher beschreiben zu wollen. Man kann das nicht beschreiben. Man kann Musik ohnehin kaum beschreiben, und diese schon mal gar nicht. Wer jetzt denkt: „Thomas Mann könnte das aber schon“, dem empfehle ich, die einschlägigen Stellen in dessen Werken noch mal genau zu lesen. Sooo toll sind die nämlich nicht.
Die Meisterschaft Mickischs beruht darauf, dass er über eine phänomenale Technik gebietet, ein Können, das einem schon mal allein als akrobatische Körpertat den Atem verschlägt. Dazu kommt aber – und das erst befähigt ihn dazu, die Seele des Zuhörers mit aller Macht zu erschüttern, zu erheben, zu verzaubern –, dass er auch vollkommen versteht, was er da spielt. Das sollte selbstverständlich sein? Gewiss, aber mit der Randbemerkung, dass die meisten, die Wagner spielen, singen, dirigieren, inszenieren, nicht verstehen, was sie da eigentlich tun, dürfte ich hier keine besondere Neuigkeit verkünden.
Meine Übersicht auf dem Gebiet ist zugegebenermaßen begrenzt, aber ich glaube nicht, dass je jemand Wagner musikalisch besser verstanden hat als Stefan Mickisch. Nicht Wagner als Künstler, da sind Nietzsche und Thomas Mann kaum zu übertreffen. Aber Mann und auch Nietzsche waren nicht Musiker genug, um diese musikalische Innenperspektive einzunehmen, die Mickisch einzunehmen und zu vermitteln in der Lage ist. Und die ihn zudem befähigt, schöpferisch mit dem vorgefundenen Material zu hantieren und Wagner scheinbar nach Belieben weiter zu fantasieren.
Apropos weiter: Ich hörte irgendwo, dass eine Einspielung der kompletten Götterdämmerung in Planung sei. Das ist eine erfreuliche Aussicht, reicht aber nicht. Keine halben Sachen, und erst recht keine viertel Sachen! Gefordert ist der ganze Ring! Ach was! Gefordert ist der ganze Wagner!
Und wenn ich Stefan Mickisch außer dieser unverschämten Forderung auch noch einen Rat geben dürfte, so würde ich ihm raten, sich vom Fernsehen fernzuhalten. So wie es alles um fünf Kilo dicker macht, so macht es auch alles kleiner und matter und banaler. Das Fernsehen bietet keinen Rahmen, in dem etwas Kunst- und Seelenvolles glänzen und sich prachtvoll entfalten kann. Die Verehrung, die wir vielen alten Meistern gegenüber heute noch empfinden, beruht nicht zuletzt darauf, dass es zu ihrer Zeit noch kein Fernsehen gab, in das sie sich hätten verirren können.
Aus aktuellem Anlass – Mickisch hat heute Geburtstag – sei dem großen Mann von dieser Stelle aus reichlich Glück gewünscht, außerdem natürlich Gesundheit, Applaus, Reichtum … was auch immer er braucht, um produktiv zu bleiben.
Und ich, der ich die Ehre habe, am selben Datum meinen Geburtstag zu feiern, wünsche mir, dass der Meister von Schwandorf zu seiner Tristanfantasie irgendwann auch noch eine Parsifalfantasie einspielen möge, in der der Karfreitagszauber mindestens eine Stunde dauert.
Wenn Ihnen dieser Text gefällt oder sonstwie lesenswert und diskussionswürdig erscheint, können Sie ihn gern online teilen und verbreiten. Wenn Sie möchten, dass dieser Blog als kostenloses und werbefreies Angebot weiter existiert, dann empfehlen Sie die Seite weiter. Und gönnen Sie sich hin und wieder ein Buch aus dem Hause Flügel und Pranke.
© Marcus J. Ludwig 2019/2021.
Alle Rechte vorbehalten.